Die Vorstellung eines „neuen Jerusalem“, einer Stadt aus Gold und Edelsteinen, durchdrungen vom Licht Gottes, ist besonders bekannt aus dem letzten Buch der Bibel – der Offenbarung des Johannes (Kapitel 21–22). Dort wird die heilige Stadt als vollendeter Ort göttlicher Gegenwart beschrieben, in der es kein Leid, keinen Tod und keine Nacht mehr gibt. Doch was viele nicht wissen: Bereits im Buch Tobit, einem deuterokanonischen Text, der in der katholischen Kirche zum Bibelkanon gehört, findet sich eine ausgeprägte Prophetie eines verherrlichten Jerusalems – ein Textabschnitt, der an sprachlicher und theologischer Nähe zur Offenbarung kaum zu überbieten ist.
Die Vision bei Tobit: Jerusalem in Gold und Edelsteinen
Im Lobpreis des Tobit in Kapitel 13 beschreibt der greise Vater die Zukunft Jerusalems in leuchtenden Farben. Nach Jahren des Exils und Leidens erhebt sich eine eschatologische Hoffnung: Jerusalem wird wieder aufgebaut – nicht in gewöhnlicher Schönheit, sondern in übernatürlicher Pracht.
„Jerusalem wird mit Saphiren und Smaragden erbaut, mit Edelsteinen deine Mauern, mit reinem Gold deine Türme und Zinnen.“ (Tobit 13,16)
„Die Straßen Jerusalems werden aus Rubin und Smaragd gebaut, aus Beryll alle seine Wege.“ (Tobit 13.17)
Diese Darstellung ist bemerkenswert: Hier wird nicht nur von einem geistlich erneuerten Jerusalem gesprochen, sondern von einem real-mystischen Ort aus kostbaren Materialien, in dem sich himmlische und irdische Dimension überlagern. Die Gassen erklingen in Lobgesang, und alle, die die Stadt lieben, werden ewig gesegnet sein (V.17).
Der sprachliche und inhaltliche Parallelismus zur Offenbarung 21,18–21 ist auffällig:
„Die Mauer der Stadt war aus Jaspis gebaut, die Stadt selbst aus reinem Gold […]. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit Edelsteinen aller Art geschmückt.“ (Offb 21,18–19)
„Die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas.“ (V.21)
Man darf mit Fug und Recht sagen: Die Offenbarung übernimmt die Vision aus Tobit – sie entfaltet sie in größerer theologischer Tiefe, aber das Motiv ist bereits im jüdischen Denken des Tobit-Buchs voll präsent.
Die Prophetie des goldenen Jerusalems in Tobit 13 ist einzigartig im alttestamentlichen Raum. Keine andere alttestamentliche Schrift beschreibt die verherrlichte Stadt in so detailreicher Schönheit wie Tobit. Der direkte Bezug zur Offenbarung 21 belegt seine Relevanz für die neutestamentliche Theologie.
Prophetien in den anderen alttestamentlichen Büchern – eher andeutungsweise
Im Gegensatz dazu sind vergleichbare Visionen im restlichen Alten Testament eher fragmentarisch oder symbolisch. Zwar finden sich bei Jesaja (Kap. 60; 65–66), Ezechiel (Kap. 40–48) und Zacharja (Kap. 2 und 14) Zukunftshoffnungen über ein erneuertes Jerusalem, doch fehlen dort die detaillierten Bildbeschreibungen einer Stadt aus Gold und Edelsteinen.
Diese alttestamentlichen Texte sprechen vom Licht über Zion, von Gottes Herrlichkeit in der Mitte seines Volkes und von einer künftigen Ordnung des Friedens. Aber: Keine dieser Visionen erreicht die konkrete und kunstvolle Ausgestaltung wie Tobit 13. Die dortige Prophetie steht inhaltlich und ästhetisch zwischen den großen Propheten und der christlichen Apokalypse – sie bildet eine theologische Brücke.
Tobit gehört zur Bibel – der protestantische Irrtum
Die katholische Kirche anerkennt das Buch Tobit seit den frühen Konzilien (u. a. Konzil von Karthago 397) als Teil der heiligen Schrift, und bestätigte dies zuletzt beim heiligen Konzil von Trient (1546), als Antwort auf die protestantischen Irrtümer der so genannten „Reformation“. Die Reformation entfernte es später aus dem Kanon, mit dem Argument, es gehöre nicht zur hebräischen Bibel (Tanach). Doch:
Das Neue Testament verweist mehrfach auf Inhalte des Tobitbuchs. Und die Apostel, sowie das Urchristentum, nutzten die Septuaginta, das griechisch überlieferte alte Testament.
Die Kirchenväter (z. B. Augustinus) betrachteten Tobit als inspiriert.
Die theologische Tiefe und Verbindung zur Apokalypse sprechen für eine kanonische Legitimität.
Die Prophetie des goldenen Jerusalems in Tobit ist kein spätes Beiwerk, sondern ein entscheidender Teil der biblischen Offenbarung, die schließlich in Christus und der Offenbarung ihren Höhepunkt findet.
In Kombination mit mehreren inhaltlichen Parallelen zum Neuen Testament ist klar: Tobit gehört legitim zur Heiligen Schrift. Die katholische Kanontradition, die Tobit einschließt, spiegelt daher nicht nur kirchliche Kontinuität, sondern auch theologische Vollständigkeit wider. Das goldene Jerusalem ist kein rein christliches Bild – es leuchtet bereits im alten Testament in den Zeilen Tobits auf.
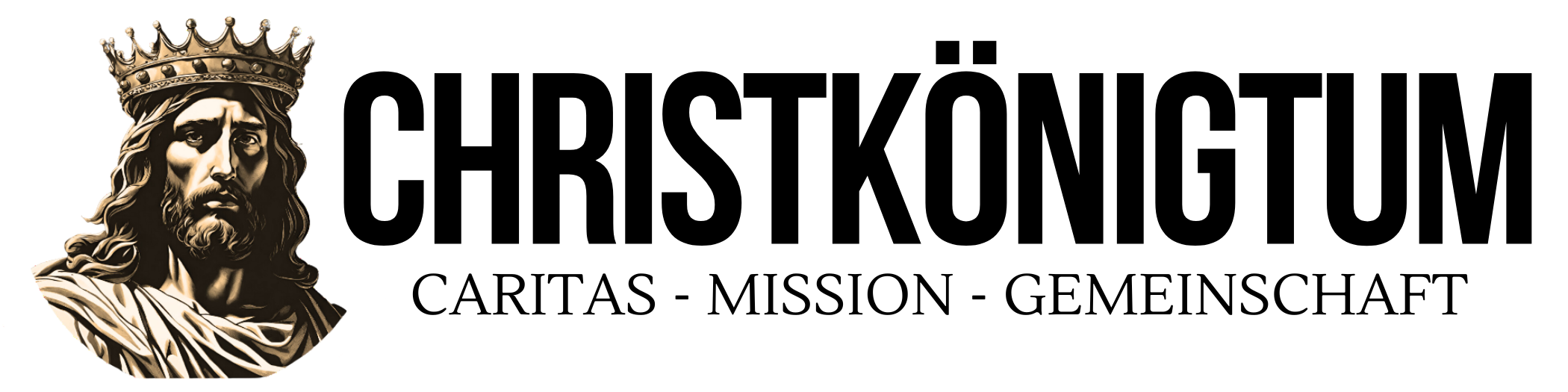









Eine Antwort
Vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag.