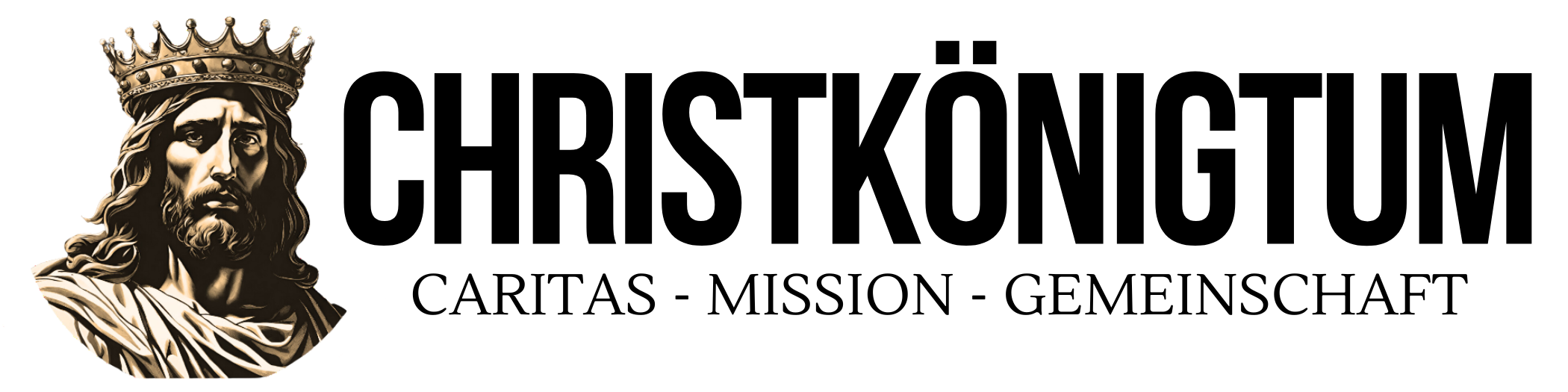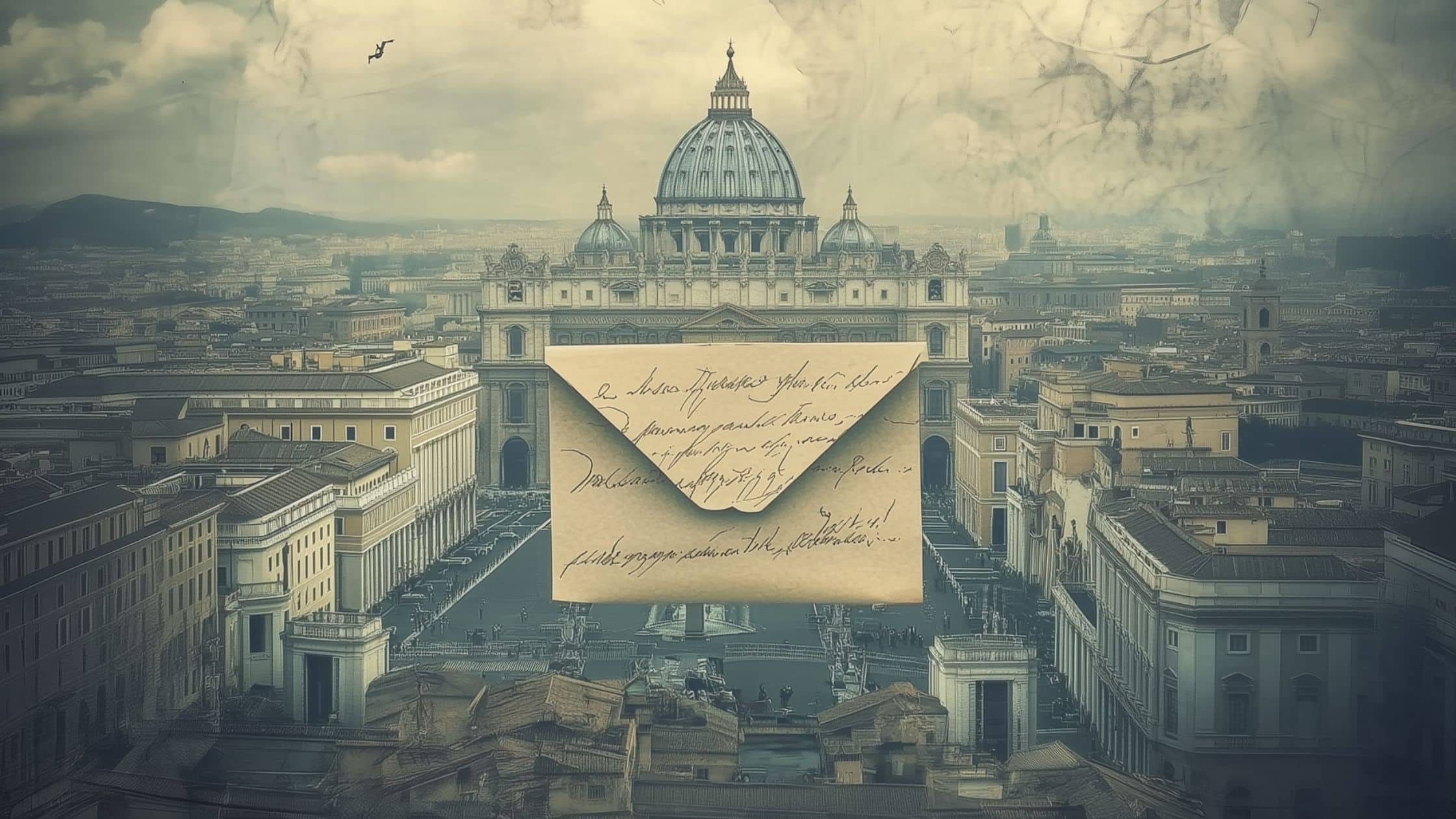Im Herbst 1974 berichtet der katholische Pfarrer Ernst Alt seinem Bischof, Dr. Josef Stangl, vom außergewöhnlichen Fall der damals 22-jährigen Anneliese Michel aus Klingenberg. Pfarrer Alt war überzeugt, dass es sich bei Anneliese nicht um einen psychischen, sondern um einen spirituellen Notfall handle. Alle Anzeichen einer dämonischen Besessenheit waren gegeben. Der Geistliche bat seinen Bischof offiziell um die Genehmigung zum Exorzismus.
Der Bischof gibt die Erlaubnis zum Exorzismus
Doch Bischof Stangl zögerte zunächst. Seine Berater und sein Generalvikar hielten eine Besessenheit für ausgeschlossen. Erst nachdem Alt am 1. Juli 1975 eigenmächtig einen Probeexorzismus durchführte und Anneliese daraufhin mit extremen körperlichen Reaktionen reagierte, gab Stangl telefonisch aus dem Urlaub seine Erlaubnis – zunächst mündlich. Am 16. September 1975 erteilte er dann offiziell die bischöfliche Genehmigung für den sogenannten großen Exorzismus, gemäß dem Rituale Romanum von 1614.
Mit dem Ritus beauftragt wurde der Salvatorianerpater Arnold Renz, der sich mehrere Tage Bedenkzeit nahm und sich intensiv auf den Fall vorbereitete. Unterstützt wurde er weiterhin von Pfarrer Alt, der Anneliese seelsorgerlich betreute und vom berühmten Exorzisten P. Rodewyk, der den Exorzisten mit Rat und Tat zur Seite stand.
Der Prozess – der Skandal beginnt
Anneliese starb durch Unterernährung und falscher Medikation durch Antiepileptika, wie einige Ärzte vermuten.
Nach dem Tod Annelieses wurde gegen Pfarrer Ernst Alt und Pater Arnold Renz Anklage erhoben. Vor Gericht gerieten die beiden Priester in eine schwierige Lage – und das ausgerechnet durch ihren eigenen Bischof. Ein Exorzismus kann einem Menschen körperlich nicht schaden, da es sich dabei bloß um Gebete handelt. Die heftigen Reaktionen der Dämonen wiederum können die Person und Umstehende in Gefahr bringen. Besessene wüten häufig gegen sich selbst und gegen andere. Oft mit unmenschlicher Kraft.
Bischof Josef Stangl, der die Exorzismen genehmigt und regelmäßig über den Zustand Annelieses informiert worden war (noch acht Tage vor ihrem Tod erhielt er einen letzten Bericht von Alt), stellte sich plötzlich gegen die Angeklagten. Er gab vertrauliche Briefe von Alt, die unter dem Schutz seelsorgerlicher Verschwiegenheit standen, an die Staatsanwaltschaft weiter. Damit brach er das Beichtgeheimnis – ein klarer Verstoß gegen Artikel 7 des Reichskonkordats von 1933, das die Unantastbarkeit seelsorgerischer Kommunikation garantiert.
Die Wiener Zeitung „Der Kurier“ schrieb am 6. April 1978 dazu unter dem Titel „Seelsorgerische Geheimnisse“:
„Ernst Alt barg, während dies verlesen wurde, seinen Kopf in den Händen. […] Und las menschlich war’s beschämend und hundsgemein – unnötigerweise auch jene Stellen, in denen sich ein Priester in seiner Seelennot seinem Bischof anvertraut hatte. […] Das hatte mit juristischer Wahrheitsfindung nichts mehr zu tun“.
Warum hat Bischof Josef Stangl, obwohl er von der Echtheit der Besessenheit überzeugt war und den Exorzismus genehmigte, später jede Verantwortung von sich gewiesen?
Warum gab er vertrauliche Briefe an die Staatsanwaltschaft weiter und brach damit das Beichtgeheimnis – einen der heiligsten Grundsätze der katholischen Seelsorge?
Warum ließ er zu, dass die beteiligten Priester allein zur Rechenschaft gezogen wurden, während er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog?
Bischof Stangl leugnet sogar die Existenz des Teufels
Und schließlich erklärte er am 11. August 1976, es gäbe „keinen Teufel“ – eine theologisch falsche Aussage, die bis heute nicht vom Bistum Würzburg geklärt wurde. Bischof Stangl, ein Mann der den öffentlichen Druck nicht mehr Stand hielt und zum Verräter wurde. Wir können wahrlich von einem Sieg des Teufels sprechen. Denn der größte Trick des Teufels ist, wie der Volksmund sagt, dass er den Menschen weiß macht, dass es ihn nicht geben würde. Seit dem Fall Klingenberg gab es keinen offiziell genehmigten Exorzismus mehr in Deutschland. Somit gibt die katholische Kirche einen großen Aspekt ihrer seelsorgerischen Tätigkeit auf.