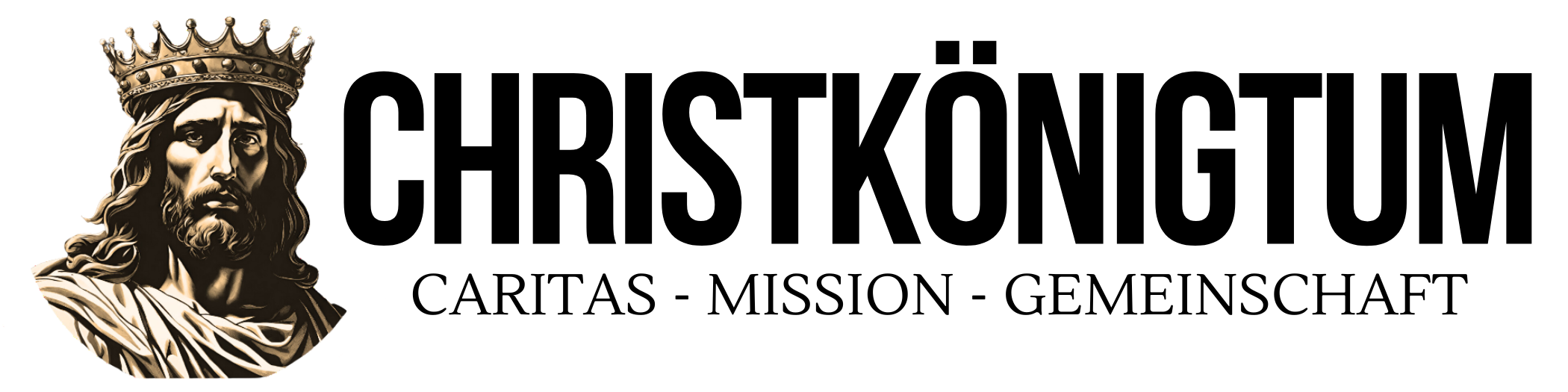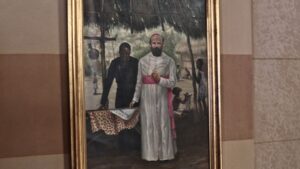Die Kreuzzüge begannen mit hohen Idealen: Im Jahr 1095 rief Papst Urban II. auf dem Konzil von Clermont die Christen Europas dazu auf, das Heilige Grab von Jerusalem aus den Händen der Muslime zu befreien. Die lateinische Christenheit antwortete mit beispielloser Hingabe – Herzöge, Könige und tausende Pilger aus allen Ländern machten sich auf den Weg in den Osten.
Eigeninteresse und Doppelspiel
Doch der Weg ins Heilige Land führte durch das Byzantinische Reich – jenes östliche Kaiserreich, das sich seit Jahrhunderten als Erbe Roms verstand, das sich aber aus Sicht vieler Kreuzfahrer in Diplomatie, Eigeninteresse und Doppelspiel verlor. Was zunächst als Bündnis begann, wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einer Geschichte gegenseitigen Misstrauens, unausgehaltener Versprechen und offener Feindseligkeit.
Es nicht der Islam allein, der den Weg zum Grab Christi erschwerte – sondern oft genug jene christlichen Kaiser in Konstantinopel, die durch Untreue, Intrigen und eigennützige Politik das Kreuz behinderten.
1. Alexios I. Komnenos (reg. 1081–1118)
– Der listige Gastgeber des Ersten Kreuzzugs
Als im Jahr 1096 die ersten Kreuzfahrerheere nach Konstantinopel kamen, herrschte dort Kaiser Alexios I. Komnenos. Er hatte Papst Urban zwar um Hilfe gegen die Seldschuken gebeten, doch als Hunderttausende bewaffneter Ritter und Pilger vor seinen Mauern lagerten, geriet er in Panik.
Statt ihnen zu trauen, ließ er sie einzeln über den Bosporus setzen – stets unter byzantinischer Aufsicht. Er zwang nahezu alle Kreuzfahrerführer (darunter auch Bohemund von Tarent) zu einem Eid, dass sie alle eroberten Gebiete dem Byzantinischen Reich zurückgeben würden.
Doch als die Kreuzfahrer 1098 Antiochia eroberten und in einer verzweifelten Lage militärische Hilfe von Alexios erwarteten, kehrte der Kaiser um. Der Kaiser wusste sehr genau, dass die Kreuzfahrer noch kämpften, entschied sich aber dennoch, seine Armee zurückzuziehen – ein klarer Verrat an jenen, die unter dem Zeichen des Kreuzes für die Befreiung des Heiligen Landes kämpften. Sein Motiv war eindeutig: Er fürchtete den wachsenden Einfluss der Kreuzritter und wollte verhindern, dass sie sich im Osten dauerhaft festsetzten – aus Sorge, ihre Macht könnte seine eigene bedrohen.
2. Johannes II. Komnenos (reg. 1118–1143)
– Der höfliche Zauderer
Johannes II., Sohn von Alexios I., regierte während der Phase zwischen dem Ersten und Zweiten Kreuzzug. Er war gebildet und taktisch klug – doch aus Sicht der lateinischen Christen war er unzuverlässig und zögerlich.
Er hatte Ambitionen in Antiochia und verlangte, dass es unter byzantinische Kontrolle käme – was zu Spannungen mit den Kreuzfahrerstaaten führte. Obwohl Johannes militärische Hilfe gegen die Muslime leistete, blieb seine Unterstützung kalkuliert und eigennützig. Die Kreuzfahrer konnten ihm nicht vertrauen.
3. Manuel I. Komnenos (reg. 1143–1180)
– Der höfische Feind
Zur Zeit des Zweiten Kreuzzugs (1147–1149) empfing Manuel I. Komnenos die großen westlichen Herrscher persönlich: Konrad III. von Deutschland und Ludwig VII. von Frankreich. Er behandelte sie mit äußerem Glanz – doch hinter den Kulissen sorgte er dafür, dass ihre Bewegungen überwacht, ihre Versorgung eingeschränkt und ihre Macht begrenzt wurde.
Es gibt Berichte, dass byzantinische Befehlshaber Informationen an muslimische Gegner weitergaben, sodass die Kreuzfahrer bei Doryläum und anderen Orten in tödliche Fallen liefen.
Auch nach dem Kreuzzug führte Manuel eine doppelte Politik: Er schloss sowohl mit den Kreuzfahrerstaaten als auch mit muslimischen Herrschern wie Nur ad-Din wechselnde Bündnisse – aus Sicht des Westens ein unentschuldbarer Verrat.
4. Isaak II. Angelos (reg. 1185–1195, 1203–1204)
– Der unfähige Schwätzer
Während der Zeit des Dritten Kreuzzugs (1189–1192), als Kaiser Friedrich Barbarossa gen Osten zog, regierte in Konstantinopel der schwache und labile Isaak II. Angelos.
Anstatt dem deutschen Kaiser freien und freundlichen Durchzug zu gewähren, hielt er ihn auf, verweigerte Unterstützung und ließ sogar einige deutsche Ritter gefangen nehmen. Erst durch militärischen Druck kam es zum Weiterzug – doch das Vertrauen war endgültig zerstört. Barbarossa verlor später sein Leben in Kilikien, und seine Armee zerfiel.
5. Alexios III. Angelos (reg. 1195–1203)
– Der Dieb des Thrones
Alexios III., Bruder Isaaks II., hatte diesen durch einen Putsch entmachtet. Als 1203 der Vierte Kreuzzug vor Konstantinopel erschien – mit dem Sohn Isaaks (Alexios IV.) an Bord –, verweigerte Alexios III. jede Verständigung und ließ das Kreuzfahrerheer verhungern und verbittern vor den Mauern der Stadt.
Er floh schließlich in der Nacht, als die Stadt fiel, mit dem Staatsschatz – ein letzter Akt der Feigheit. Doch damit begannen neue Intrigen.
6. Alexios IV. Angelos (reg. 1203–1204)
– Der Kaiser der gebrochenen Versprechen
Alexios IV. verdankte den Kreuzfahrern sein Leben und seine Krone – doch kaum eingesetzt, vermochte er kein einziges seiner großspurigen Versprechen einzulösen. Er hatte 200.000 Silbermark zugesagt, Schiffe, Truppen und die Unterwerfung der orthodoxen Kirche unter den Papst. Doch weder das Volk noch der Klerus unterstützten ihn.
In Konstantinopel wuchs der Hass gegen die „Lateiner“, und im Januar 1204 wurde Alexios IV. gestürzt und ermordet – erneut ein Bruch des Treueverhältnisses, diesmal mit tödlichem Ausgang. Die Kreuzritter fühlten sich verraten, beraubt und gedemütigt – was zur endgültigen Entscheidung führte, die Stadt zu erobern.
7. Alexios V. Dukas (reg. Januar–April 1204)
– Der letzte Feind
Der neue Kaiser, Alexios V. Dukas (genannt Mourtzouphlos), weigerte sich, den Kreuzrittern auch nur ein Silberstück zu zahlen. Er tötete ihren Verbündeten (Alexios IV.), verhöhnte ihre Forderungen und rüstete sich zur Verteidigung.
Für die Kreuzritter war er kein legitimer Herrscher, sondern ein Mörder und Usurpator. Der letzte Rest an Geduld war erschöpft – und am 13. April 1204 wurde Konstantinopel gestürmt, geplündert und unter lateinische Herrschaft gebracht.
Eine Chronik des Verrats
Die Geschichte der Kreuzzüge ist auch eine Chronik byzantinischen Misstrauens und mehrfachen Verrats. Vom Ersten bis zum Vierten Kreuzzug begegneten die Ritter aus dem Westen in Konstantinopel nicht Verbündeten, sondern Zögerern, Lügnern, Doppelspielern – Herrschern, die lieber mit Sarazenen paktierten, als mit dem Kreuz zu marschieren.
Die Plünderung Konstantinopels im Jahr 1204 war nicht der Anfang, sondern das Ende eines langen Prozesses des Vertrauensverlusts. Aus Sicht der Kreuzritter war es nicht Raub, sondern Vergeltung. Nicht Habsucht, sondern Enttäuschung. Die Eroberung einer Stadt, die längst ihr geistliches Anrecht verwirkt hatte.
So mahnt uns die Geschichte: Der schlimmste Feind des Kreuzes ist nicht immer nur der Ungläubige – manchmal ist es der angebliche Bruder, der das Kreuz nicht mehr trägt.