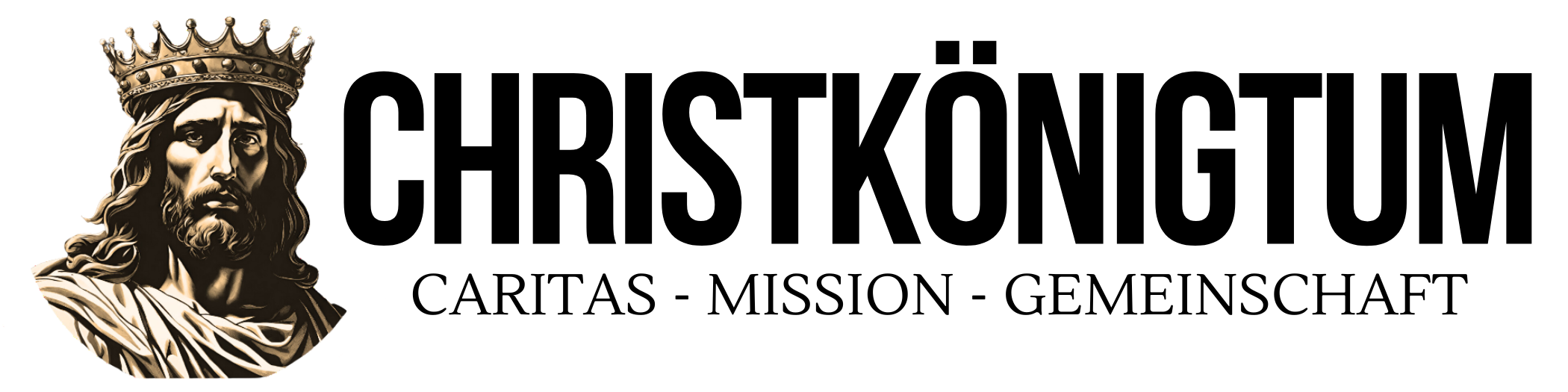Inmitten der Erhabenheit der katholischen Heilslehre gibt es kaum ein Bild, das so tief in das Herz des Gläubigen greift wie jenes der schmerzhaften Muttergottes – Maria, Mater Dolorosa, deren Herz vom Schwert des Leidens durchbohrt wurde. Der heilige Simeon hatte es vorausgesagt: „Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen.“ (Lk 2,35) Und so geschah es: das Leben Mariens war mit dem Leiden ihres göttlichen Sohnes auf das Innigste verbunden. Schon früh in der kirchlichen Überlieferung wurde ihr Schmerz verehrt – doch eine besonders tiefe und systematisierte Betrachtung fand er in der Andacht zu den Sieben Schmerzen Mariens, wie sie besonders durch die Ordensgemeinschaft der Serviten im 13. Jahrhundert verbreitet wurde.
„Der Sohn hing am Kreuz, und Maria war in der Nähe des Kreuzes. Der Sohn war am Kreuz befestigt, und das Kreuz war im Herzen Mariens befestigt. Es gab nur ein Kreuz, aber es gab zwei Gekreuzigte.“
–hl. Thomas von Villanova
Ursprung und Entwicklung der Andacht
Die Diener Mariens (Servitenorden), gegründet um das Jahr 1233 in Florenz, hatten eine tiefe Verehrung für die leidende Muttergottes. Ihre Andacht über das Leiden Christi führte sie unmittelbar zur Betrachtung des Mitleidens Mariens.
Schon im frühen 15. Jahrhundert wurde diese Form der Frömmigkeit auch kirchlich gefördert: auf der Kölner Synode im Jahre 1423 wurde erstmals die Einführung eines eigenen Festes zu Ehren der Schmerzen Mariens empfohlen – ein bemerkenswerter Ausdruck des liturgischen Sinnes jener Zeit für das Leiden der Gottesmutter.
Diese Anregung fand ihre Vollendung in der universalen Kirche, als Papst Benedikt XIII. im Jahre 1727 das Fest der Sieben Schmerzen Mariens für die ganze Kirche vorschrieb. Es wurde auf den Freitag vor dem Palmsonntag festgelegt – jenem liturgischen Augenblick, da sich das Leiden Christi immer mehr in das Zentrum der Betrachtung rückt. Später wurde ein zweites Fest am 15. September hinzugefügt, unmittelbar nach dem Fest der Kreuzerhöhung, um die untrennbare Verbindung Mariens mit dem Kreuzesopfer ihres Sohnes hervorzuheben. Papst Pius VII. erhob dieses spätere Fest 1817 feierlich zur Bitte um Hilfe in Zeiten kirchlicher Bedrängnis.
Die Sieben Schmerzen im Einzelnen
Die Kirche ruft uns in der traditionellen Betrachtung sieben zentrale Leiden Mariens ins Gedächtnis. Diese Schmerzen sind nicht bloß historische Begebenheiten – sie sind geistliche Betrachtungspunkte, Spiegelbilder unserer eigenen Kreuzwege, aber vor allem Ausdruck der übernatürlichen Liebe und Miterlösung Mariens.
1. Die Weissagung Simeons
– Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Schon beim ersten öffentlichen Auftritt mit dem göttlichen Kind im Tempel erfährt Maria, dass ihr Weg kein triumphaler, sondern ein schmerzensreicher sein wird.
2. Die Flucht nach Ägypten
– Verfolgt von einem grausamen König muss die Heilige Familie ins heidnische Exil. Maria trägt das göttliche Kind nicht nur im Schoß, sondern durch die Wüste – fern von Heimat, unter Lebensgefahr.
3. Der Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tempel
– Drei Tage lang lebt Maria in qualvoller Ungewissheit. Der göttliche Sohn ist verschwunden. Ihre Liebe, ihre Sorge – sie sind vollkommen menschlich und zugleich von übernatürlicher Geduld getragen.
4. Die Begegnung mit Jesus auf dem Kreuzweg
– Kein Schmerz gleicht jenem, den eine Mutter empfindet, wenn sie ihr gequältes Kind leidend und blutend sieht. Diese Szene, in der sich ihre Blicke kreuzen, ist von unergründlicher Tiefe.
5. Die Kreuzigung und der Tod Jesu
– Sie steht am Fuß des Kreuzes. Ohne Ohnmacht, ohne Wehklage, ganz hingegeben. Maria ist dort nicht nur als Mutter – sie ist die Miterlöserin, die mit dem Neuen Adam das Opfer vollzieht.
6. Die Abnahme Jesu vom Kreuz
– Der entstellte Leichnam Jesu wird ihr in die Arme gelegt. Pietà – das ergreifende Bild der Mutter mit dem toten Sohn auf dem Schoß – ein Sinnbild des vollkommenen Opfers.
7. Die Grablegung Jesu
– Maria muss loslassen. Sie gibt IHN dem Grab hin, dem Tod, in Hoffnung auf die Auferstehung. Doch ihr Schmerz ist dennoch unermesslich.
„Die schmerzhafte Mutter sollst du niemals vergessen.
Ihre Schmerzen sollen immer in dein Herz eingegraben sein und es in Liebe zu ihr und zu ihrem Sohn entflammen!“
-hl. Pater Pio
Das Fest der Sieben Schmerzen
Das liturgische Fest wurde bis zur Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zweimal jährlich gefeiert:
Am Freitag vor Palmsonntag
Am 15. September
Die Messe im tridentinischen Ritus ist durchdrungen von tiefer Symbolik. Die Orationen betonen das mitleidende Herz Mariens, die Epistel stammt aus den Klageliedern des Jeremias, das Evangelium beschreibt jene schmerzhafte Begegnung Mariens mit dem Kreuz. Gläubige wurden angehalten, sich durch Fasten, Beichte und innerliche Sammlung diesem Fest mit ganzem Herzen zu widmen.
Erscheinungen und marianische Offenbarungen
Noch bevor das Zeitalter der großen Marienerscheinungen begann, wurde die schmerzhafte Muttergottes in Visionen von Heiligen geoffenbart:
Der hl. Brigid von Schweden wurden die sieben Schmerzen offenbart.
Die hl. Catherine de Ricci und die hl. Veronica Giuliani erfuhren in mystischer Vereinigung den Schmerz Mariens leiblich nach.
Die barocke Frömmigkeit machte die Mater Dolorosa zum Mittelpunkt unzähliger Prozessionen, Klagelieder, Fastenspiele und Altäre.
Der Rosenkranz der Sieben Schmerzen
Als besonderes Mittel zur Verehrung entwickelte sich der Rosenkranz der Sieben Schmerzen Mariens, bestehend aus sieben Gruppen von je sieben Ave Maria. Jede Gruppe wird eingeleitet durch die Betrachtung eines der sieben Schmerzen, gefolgt von einem Vaterunser. Dieses Gebet, in Klöstern und Familien gepflegt, wurde zur geistlichen Übung vieler Generationen.
Die Verheißungen Mariens an die hl. Brigitta von Schweden
Am 15. September gedenkt die Kirche in besonderer Weise der Schmerzen Mariens. Doch diese Andacht ist nicht an ein Datum gebunden. Die Gottesmutter hat der hl. Brigitta von Schweden (1303–1373) in mystischer Offenbarung große Verheißungen gegeben – nicht für theologische Gelehrte oder Ordensleute allein, sondern für einfache, gläubige Seelen, die täglich mit dem Herzen beten.
„Ich sehe auf alle Menschen in der Welt, ob einzelne wohl auch mit mir leiden und meiner Schmerzen gedenken; aber nur sehr wenige finde ich.“
-Maria zur hl. Birgitta von Schweden
Maria versprach:
„Ich schaue mit besonderem Erbarmen auf jene, die täglich meiner Tränen und Schmerzen gedenken und mich ehren.“
Wer täglich sieben Ave Maria betet und dabei die Schmerzen Mariens betrachtet und nach Möglichkeit die Andacht verbreitet, dem werden folgende Gnaden geschenkt:
1. Friede in der Familie
– Maria, Königin des Friedens, nimmt die Familien, die ihr tägliches Leiden betrachten, unter ihren besonderen Schutz. Viele gläubige Häuser berichten von sichtbaren Veränderungen in Stimmung, Liebe und Eintracht.
2. Erleuchtung in göttlichen Geheimnissen
– Die Betrachtung des Schmerzes führt zur Weisheit. Maria öffnet die Augen des Herzens für die Geheimnisse des Glaubens, die nur in der Schule des Kreuzes zu erlernen sind.
3. Erhörung der Bitten
– Nicht in weltlicher Willkür, sondern im göttlichen Plan: alle Bitten, die dem Willen Gottes entsprechen und dem Seelenheil nützlich sind, werden durch Mariens Fürbitte erfüllt.
4. Ewige Freude in Jesus und Maria
– Jene, die ihr hier auf Erden im Leid nahe sind, sollen ihr einst in der Freude des Himmels für immer begegnen. Die Tränen der Erde werden durch ewige Seligkeit abgewischt.
Diese Andacht ist keine bloße Wiederholung von Gebeten. Sie ist ein täglicher Akt der Liebe.
So einfach, so tief, so mächtig und so reich an Gnade.
Theologische Tiefe und Bedeutung
Die Lehre der Miterlösung Mariens war über Jahrhunderte ein fester Bestandteil der kirchlichen Spiritualität. Der hl. Alfons Maria von Liguori spricht von der „Königin der Märtyrer“, weil ihr Leid das tiefste aller Geschöpfe war – denn sie litt nicht nur körperlich, sondern geistlich mit ihrem Sohn. Ihr Schmerz war ein bewusster Akt der Mitopferung – nicht bloß Trauer, sondern mitleidende Hingabe.
„Ihr Mitleiden war eine Passion in einer besonderen Form.“
Ihre Worte an die hl. Brigitta drücken dies aus:
„Das Leiden Christi war mein Leiden, weil sein Herz mein Herz war. Denn wie Adam und Eva die Welt um einen einzigen Apfel verkauften, so erlösten mein Sohn und ich die Welt mit einem Herzen.“
Die Kirche lehrt unmissverständlich: Jesus Christus allein ist der wahre und einzige Erlöser der Welt – im eigentlichen, höchsten und vollkommenen Sinne. Kein Geschöpf teilt diese Ehre mit ihm. Wer also Maria als „Miterlöserin“ im gleichen Sinne wie Christus nennt, begeht Irrtum oder gar Lästerung.
Und doch lehrt die überlieferte Theologie, was P. Frederick William Faber in fünf kraftvollen Sätzen zusammenfasst:
1. Unser Herr ist der alleinige Erlöser der Welt im eigentlichen Sinne. In dieser höchsten Wirklichkeit kann kein Geschöpf mit ihm gleichgestellt oder ihm beigesellt werden.
2. In einem untergeordneten, sekundären Sinne jedoch wirken alle Auserwählten mit Christus an der Erlösung mit – nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gnade, als Glieder seines mystischen Leibes.
3. In diesem Sinne, aber in einem unvergleichlich höheren Grad, wirkte Maria mit Christus an der Erlösung – in einer Weise, wie kein anderes Geschöpf es jemals tat oder tun könnte.
4. Neben ihren Schmerzen nahm sie auch durch ihr einzigartiges Fiat, ihre vollkommene Zustimmung zur Opferhingabe Christi, an diesem Erlösungswerk teil – auf eine Weise, die niemand sonst erreicht.
5. Gerade durch ihre Schmerzen wirkte sie an der Erlösung mit – auf eine eigene, einzigartige Weise, die nicht nur die allgemeine Mitwirkung der Auserwählten übertrifft, sondern auch ihre eigene sonstige Mitwirkung bei weitem überragt.
Diese fünf Wahrheiten stellen die Rolle Mariens in einem klaren und sicheren Licht dar. Zwar ist es Glaubenswahrheit, dass Christus allein die Erlösung vollbracht hat. Doch die Auserwählten wirken mit – durch die Gnade, die ihnen durch ihn zuteilwurde. Ihre Verdienste, ihre Opfer, ihre Buße – sie haben nur Kraft, weil sie in ihm und mit ihm geschehen.
Der heilige Paulus spricht davon, dass wir an unseren Leibern ergänzen, was „an den Leiden Christi für seinen Leib, die Kirche, noch mangelt“ (Kol 1,24). Das heißt nicht, dass das Kreuz unvollkommen war – sondern dass seine Früchte in den Gliedern fortwirken müssen. So nehmen wir durch das mystische Mitleiden Anteil am Erlösungswerk – durch Zulassung, Gnade und Unterordnung unter das Kreuz Christi.
Und doch: Kein Heiliger, kein Märtyrer, kein Apostel kommt Maria in dieser Mitwirkung auch nur nahe. Ihre Heiligkeit überragt alle Heiligen gemeinsam. Ihre Verdienste tragen ein Maß, das – verglichen mit den anderen – beinahe unendlich erscheint. Ihr Martyrium, ihr Schmerz, ihre Liebe – sie sind wie Sonne zu Schatten.
So darf man mit Recht sagen: Wenn es einen wahren und bedeutenden sekundären Sinn gibt, in dem Menschen an der Erlösung mitwirken – dann ist Maria seine vollkommenste und einzig wahre Verkörperung. Sie ist Miterlöserin, nicht weil sie der Erlöserin gleichkäme, sondern weil sie in einer Tiefe und Weise mitwirkte, die kein anderer je erreicht hat – nicht nur bildlich, sondern tatsächlich, substantiell, einmalig.
Ihre Mitwirkung war nicht symbolisch – sie war real, leidvoll, willentlich. Sie stand nicht nur unter dem Kreuz – sie stand im Herzen des Opfers. Ihre Seele war durchbohrt mit jenem Schwert, das Christus durchbohrte. Deshalb rufen wir sie zu Recht an als:
Mater Dolorosa – Miterlöserin – Königin der Märtyrer.
Wer in einer oberflächlichen Zeit das Leid flieht, findet in Maria eine Lehrmeisterin des Kreuzes. Ihr Schmerz verwandelt das dunkle Leid in lichtvolle Hingabe. Sie zeigt: Es gibt keinen Karfreitag ohne Ostersonntag – und keinen Weg zu Christus ohne das Kreuz.
Wenn wir also mit ihr am Fuße des Kreuzes stehen, dann stehen wir richtig – mitten im Zentrum der Erlösung. Dort, wo der Schmerz zur Liebe wird, und die Liebe zur ewigen Freude.