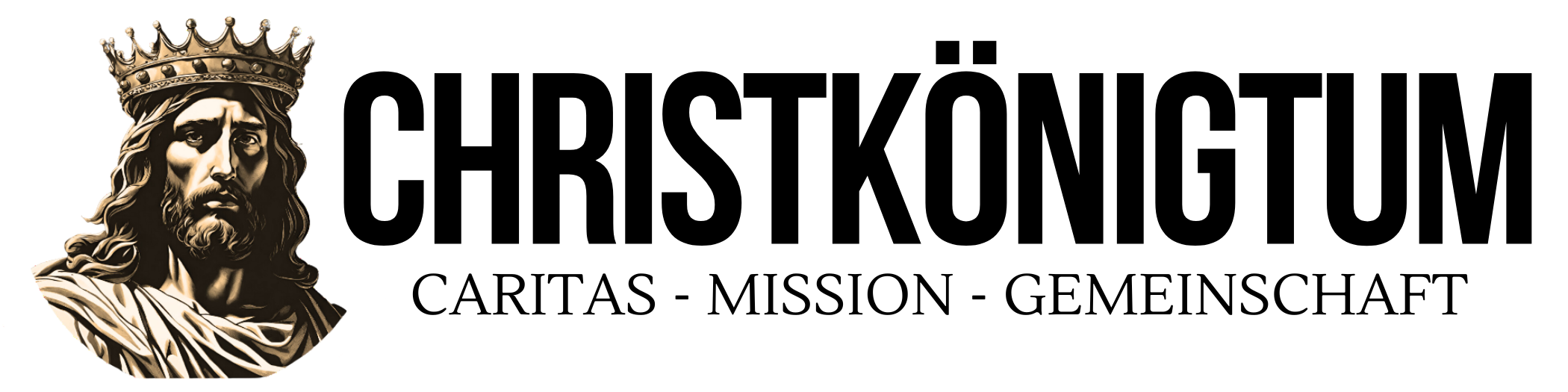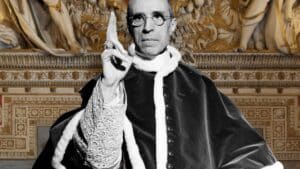Ein verborgenes Geheimnis des Passahmahls, ein Kelch am Kreuz und die größte Herausforderung für den Protestantismus.
Ein Rätsel beim letzten Abendmahl
Es war die Nacht vor dem Kreuz. Jesus saß mit seinen Jüngern zu Tisch und feierte das jüdische Passahmahl – ein uraltes Ritual, das an die Befreiung Israels aus der Sklaverei erinnerte. Brot wurde gebrochen, Wein getrunken, Psalmen gesungen. Doch wer genau hinschaut, entdeckt etwas Merkwürdiges – eine Lücke, ein offenes Ende.
Im traditionellen jüdischen Passahmahl (Seder) werden nämlich vier Becher Wein getrunken, jeder mit symbolisch-liturgischer Bedeutung, abgeleitet aus den vier Verheißungen Gottes in Exodus 6,6–7:
1. „Ich werde euch herausführen aus der Knechtschaft Ägyptens.“
→ Becher der Heiligung – Anfang des Mahls, Segnung des Tages
2. „Ich werde euch erretten aus der Sklaverei.“
→ Becher des Gerichts – Erinnerung an das Leiden in Ägypten und die Plagen
3. „Ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm.“
→ Becher der Erlösung – zentraler Teil, Trinken nach dem Hauptmahl
4. „Ich werde euch als mein Volk annehmen und euer Gott sein.“
→ Becher der Vollendung / Lobpreis – Abschluss der Liturgie mit Psalmen
Diese vier Becher strukturieren das gesamte Mahl. Der vierte Becher ist der krönende Abschluss – ein Symbol für die vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk, ein Vorausbild des messianischen Reiches.
Das gebrochene Ritual
Schaut man nun auf das letzte Abendmahl, fällt etwas auf: Jesus trinkt nicht den vierten Becher. Stattdessen sagt er:
„Ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich es neu trinke im Reich Gottes.“ Mk 14,25
Das Passah wird unterbrochen. Der vierte Becher bleibt unausgesprochen.
War das ein Zufall? Eine Abkürzung? Nein – es ist liturgische Absicht. Jesus hat das Passahmahl nicht beendet. Er hat es aufgeschoben, um es am Kreuz zu vollenden. Genau das ist der Schlüssel zum tieferen Verständnis der Eucharistie – und zum Dilemma der Reformation.
Gethsemane und der Becher des Gehorsams
In der Nacht betet Jesus im Garten Gethsemane:
„Mein Vater, wenn dieser Becher nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.“ Mt 26,42
Er spricht vom Becher, den er noch nicht getrunken hat. Nicht bloß symbolisch, sondern als Fortsetzung des Passahmahls. Das Mahl ist noch offen – der vierte Becher steht noch aus. Und Jesus weiß: Dieser Kelch ist sein eigenes Leiden.
Am Kreuz – Der vierte Becher wird getrunken
Nun wird das Bild vollkommen. In Johannes 19,28–30 heißt es:
„Jesus sagte: Ich habe Durst. […] Sie hielten ihm einen mit Essig getränkten Schwamm an den Mund. Als Jesus davon genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht.“
Der Essig ist saurer Wein – ein Alltagsgetränk der römischen Soldaten. Aber für Jesus ist es der vierte Becher. Er nimmt ihn – und dann sagt er:
„Es ist vollbracht.“
Das neue Pascha ist jetzt vollendet. Der vierte Becher ist getrunken – nicht im Saal, sondern auf dem Kreuz, am Altar.
Die Eucharistie – mehr als ein Mahl
Jesus hat das Passah nicht einfach neu interpretiert. Er hat es vollendet – und in diesem Zusammenhang ist das letzte Abendmahl nicht nur ein Mahl, sondern die Einsetzung eines neuen Opfers, einer neuen Liturgie:
„Das ist mein Leib […] das ist der Kelch meines Blutes, des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird.“
Im jüdischen Denken schafft das Wort Wirklichkeit – ganz besonders im Kult. Wenn Jesus sagt „Das ist mein Leib“, dann ist es sein Leib.
Die katholische Kirche hat diese Wahrheit bewahrt:
Die Eucharistie ist nicht nur Symbol, sondern sakramentale Gegenwart des Kreuzesopfers – das einzige, vollkommene Opfer, das auf unblutige Weise in jeder Messe gegenwärtig wird.
Das protestantische Dilemma – Symbol oder Wirklichkeit?
Die Reformation, so sehr sie gegen Missstände kämpfte, war theologisch tief gespalten, vor allem in der Frage der Eucharistie.
Lutheraner
Martin Luther glaubte an die Realpräsenz, jedoch in der Form der sogenannten Konsubstantiation: Christus sei „in, mit und unter“ Brot und Wein gegenwärtig – aber das Brot bleibe Brot.
Was jedoch fehlt, ist der Gedanke der sakramentalen Vergegenwärtigung des Opfers. Für Luther ist die Messe kein Opfer, sondern eine Gnadenhandlung.
Calvinisten
Johannes Calvin ging noch weiter: Er sah das Abendmahl als geistliche Gemeinschaft mit Christus, aber lehnte jede reale Gegenwart in den Elementen ab. Das Brot bleibt Brot. Der Wein bleibt Wein. Es ist reine Erinnerung, „geistlich nahrhaft“, aber nicht substantiell.
Beide Traditionen teilen das gleiche Problem:
Wenn das Abendmahl nur eine Erinnerung ist, warum trank Jesus den vierten Becher nicht beim Mahl, sondern erst am Kreuz Wenn das Abendmahl kein Opfer ist, warum spricht Jesus von einem „Kelch des neuen Bundes“, der für euch vergossen wird?Wenn Brot und Wein nicht verwandelt werden – warum stellt Jesus sie so deutlich in Beziehung zu seinem Leib und Blut? Diese Fragen lassen sich in einem symbolischen Verständnis nicht zufriedenstellend beantworten.
Die katholische Antwort ist die einzige, die alle biblischen, liturgischen und theologischen Stränge zusammenführt:
Das letzte Abendmahl ist der Anfang des Opfers.
Das Kreuz ist die Vollendung des Opfers.
Die Eucharistie ist die sakramentale Gegenwart dieses einen, ewigen Opfers.
Einladung zur Wiederentdeckung des Altars
Der vierte Becher ist mehr als ein Bild. Er ist der Schlüssel zum Verständnis des neuen Bundes. Er zeigt, dass das Kreuz nicht bloß Gericht, sondern Liturgie ist. Christus ist nicht nur Opferlamm, sondern auch Hohepriester – und die Messe ist sein ewiges Opfer, dargebracht für uns.
„Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.“
Wer die Eucharistie versteht, erkennt: Hier ist nicht Brot – hier ist der Himmel selbst geöffnet. Das, was am Kreuz begann, wird auf jedem Altar real gegenwärtig.
Für Protestanten, die ehrlich suchen, ist das eine offene Einladung zur Rückkehr an den Tisch des Herrn. Der vierte Becher ist getrunken. Das Opfer ist vollbracht.
Komm und koste – das ist der wahre Kelch der Erlösung.