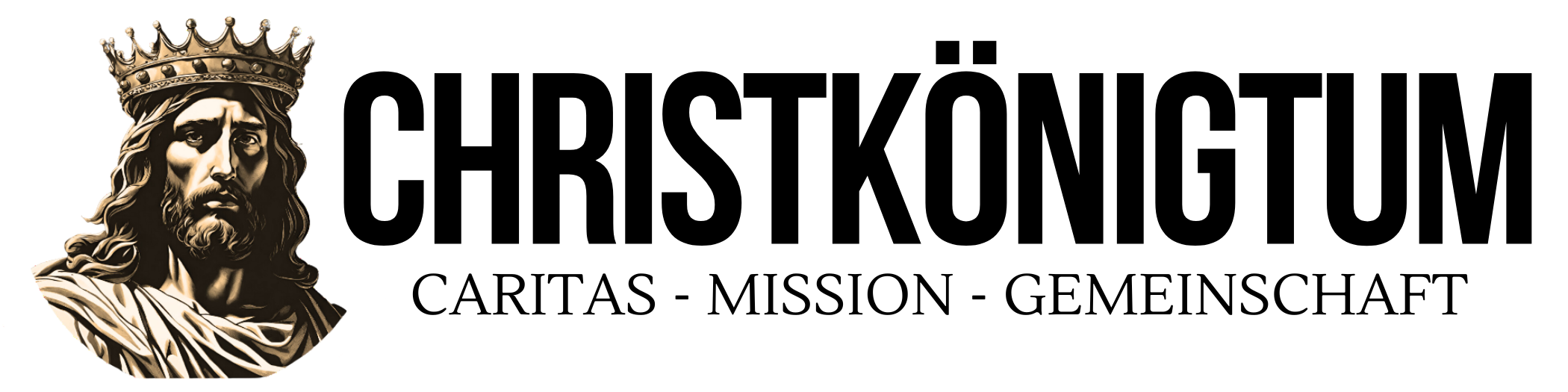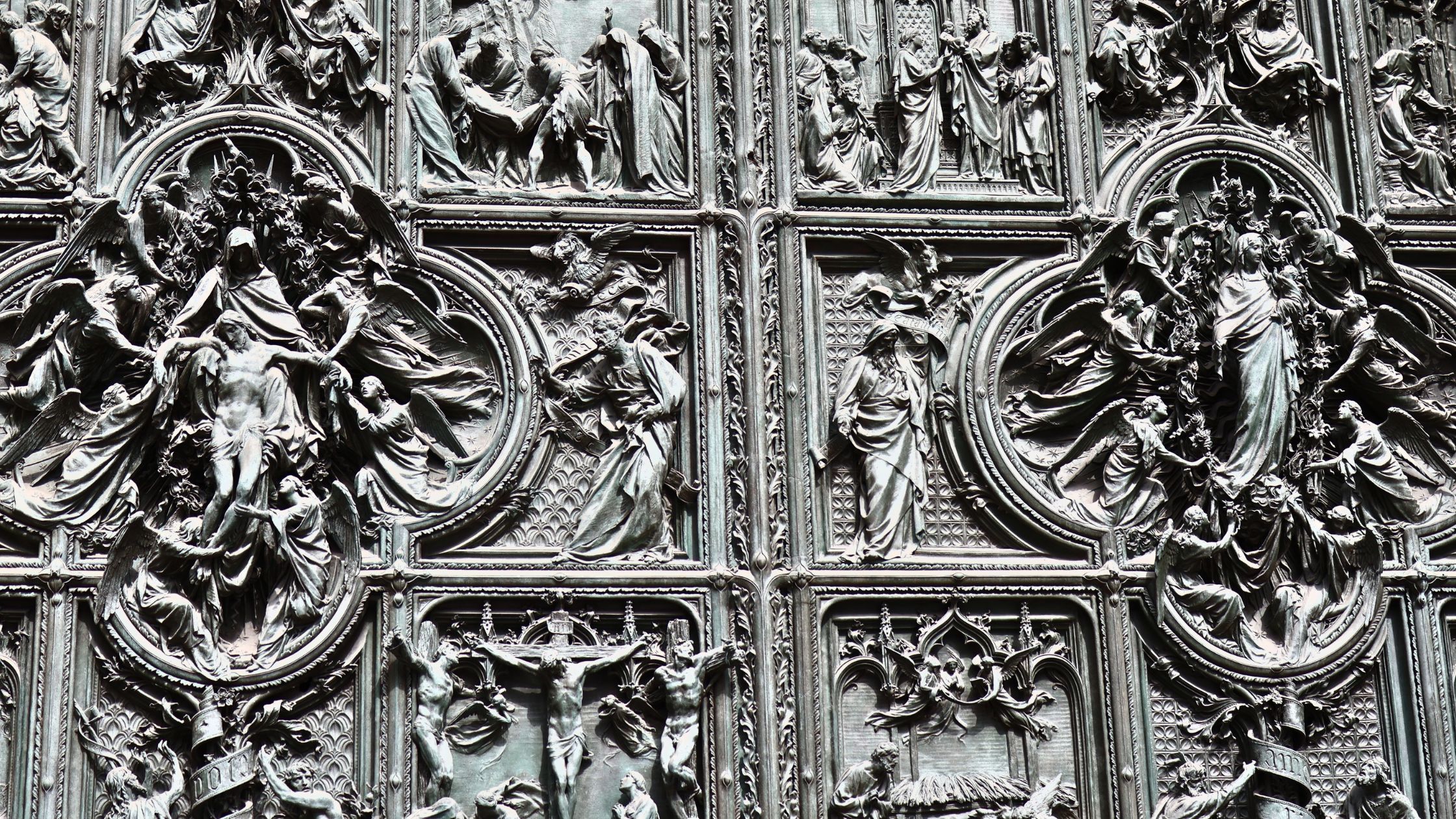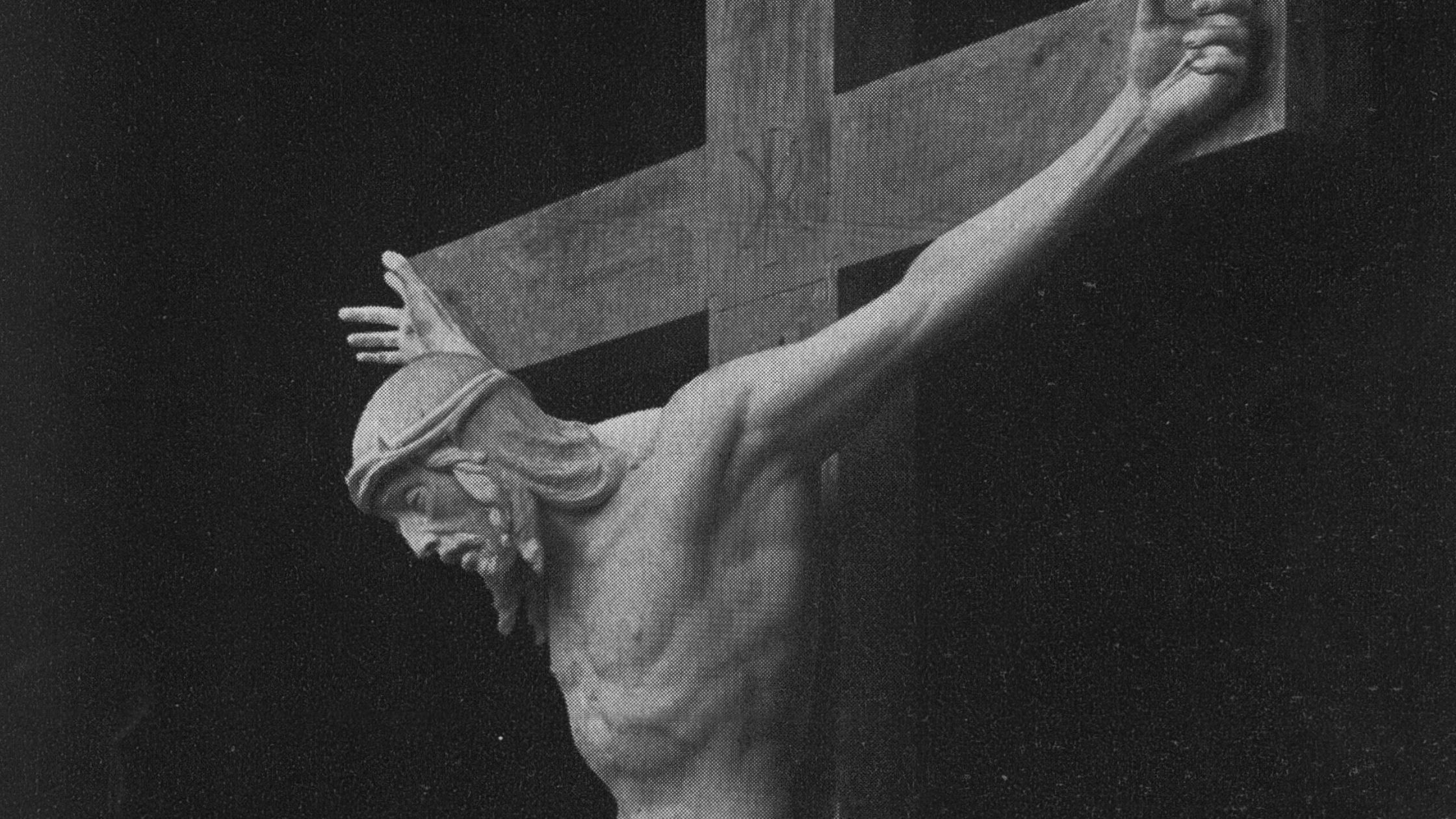„Ehe ich dich formte im Mutterleib“, spricht Gott, „habe ich dich erkannt“[1]. Jeder einzelne Mensch kann Gott antworten: „Mein Werden war nicht verborgen vor dir, als im Verborgenen ich wurde, gewirkt in irdischen Tiefen. Deine Augen sahen mich als gestaltlosen Keim, und in deinem Buch standen schon all die Tage verzeichnet, die mir vorausbestimmt wurden, als noch keiner von ihnen war“[2]. „Hast du mich nicht hingegossen wie Milch, mich gerinnen lassen wie Käse, mich dann bekleidet mit Fleisch und mit Haut und durchzogen mit Knochen und Sehnen?“[3] „Meine Nieren hast du ja geschaffen, mich im Schoß meiner Mutter gewoben“[4]. „Ja, du ließest mich aus dem Mutterschoß kommen, bargst mich an meiner Mutter Brust. Von Kind an bin ich auf dich gestellt, vom Schoß meiner Mutter an bist du mein Gott“[5]. Gemäß Methodios von Olympos († um 311) ist Gott „der Fürst der Künstler, der zum vernünftigsten, lebensvollen Bilde seiner selbst uns Menschen machte und formte aus dem feuchten winzigen Samen im Mutterleibe, dem Wachskünstler gleich“[6]. Er ist „der Herr, dein Schöpfer, dein Bildner, dein Helfer vom Mutterleib an“[7]. Für „das Leben des Menschen“ fordert Gott „Rechenschaft von jedem seiner Brüder“[8].
Abtreibung wird in einer Reihe frühchristlicher Schriften thematisiert. Gemäß der Zwölfapostellehre (1./2. Jh.) soll man „nicht das Kind durch Abtreiben umbringen und das Neugeborene nicht töten“[9]. Im Barnabasbrief, der um das Jahr 130 verfasst wurde, liest man: „Töte das Kind nicht durch Abtreibung, noch auch töte das Neugeborene!“[10] Athenagoras von Athen († 190) legt den christlichen Standpunkt dar, nach dem „jene Frauen, die zur Herbeiführung eines Abortus Medikamente anwenden, Menschenmörderinnen sind und sich einst bei Gott darüber zu verantworten haben“, denn „der Embryo sei schon ein Mensch und Gegenstand göttlicher Fürsorge“[11]. Clemens von Alexandrien († um 215) wendet sich gegen die Praxis derer, die „mit den Mitteln einer frevelhaften Kunst das durch Gottes Vorsehung entstehende neue Menschenleben töten“ und erwähnt „zu völligem Verderben führende Abtreibmittel“, die „zugleich mit der Leibesfrucht auch alle Menschlichkeit zunichte“ machen[12]. Tertullian († nach 220) beschreibt die christliche Haltung: „Wir aber dürfen, da der Mord uns ein für allemal verboten ist, auch den Fötus im Mutterleibe, während noch das Blut zur Bildung eines Menschen absorbiert wird, nicht zerstören“[13]. Minucius Felix schreibt im 2./3. Jh. von Frauen, die „im eigenen Leibe durch eingenommene Arzneien den Keim künftigen Lebens“ vernichten und so „einen Kindsmord“ begehen, „ehe sie gebären“[14]. Die Philosophumena (3. Jh.) erwähnt „sogenannte Christinnen“, die sich gewisser Praktiken bedienen, „um die Leibesfrucht abzutreiben“ und nennt dies „Mord“[15]. In den Apostolischen Konstitutionen (4. Jh.) liest man: „Du sollst dein Kind nicht durch Abortus tödten, noch das Geborne morden; denn das Gebilde, welches eine Seele von Gott erhalten hat, wird, wenn gemordet, gerächt werden, weil ungerecht getödtet“[16]. Basilius von Caesarea († 379) betrachtet eine Frau, die „absichtlich die Leibesfrucht abtreibt“ als des „Mordes schuldig“, lehnt die „spitzfindige Unterscheidung zwischen ausgebildeter und gestaltloser Leibesfrucht“ ab, bezeichnet „die Vernichtung des Embryo“ als „Mord“[17] und nennt „diejenigen Mörderinnen, die Arzneien zur Abtreibung der Leibesfrucht geben wie auch die, welche das embryotötende Gift nehmen“[18]. Ambrosius von Mailand († 397) wendet sich gegen jene, die „durch fruchtabtreibende Säfte schon im Mutterschoße den Tod der eigenen leiblichen Kinder“ bewirken[19]. Johannes Chrysostomos († 407) nennt Abtreibung „etwas Schlimmeres noch als Mord“, da „nicht einem geborenen Wesen das Leben“ genommen wird, sondern verhindert wird, „daß es überhaupt geboren wird“ und er beschuldigt den Mann, der einer Hure beiwohnt, die Frau, die „zum Kindergebären da ist, zum Morde“ zu führen, „denn wenn die Untat auch von ihr begangen wird“, ist doch der Mann „die Veranlassung dazu geworden“[20]. Hieronymus († 420) erwähnt Frauen, die „zum Mörder am Ungeborenen“ werden[21].
Elisabeth rief angesichts ihrer Begegnung mit Maria erfüllt von Heiligem Geist[22]: „Woher wird mir die Gnade, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, sobald dein Gruß an mein Ohr klang, frohlockte das Kind vor Freude in meinem Schoß“[23]. Tertullian wendet sich an die Frauen: „Denn in diesem Punkte gibt es keine geeigneteren Lehrer, Richter und Zeugen als das weibliche Geschlecht. Gebt also Antwort, ihr Mütter, Schwangern und Gebärenden, die Unfruchtbaren aber und die Männer sollen schweigen! Man wünscht zu erfahren, wie sich eure Natur in Wirklichkeit verhalte, man forscht nach zuverlässigen Wahrnehmungen bei euch, ob ihr in eurer Leibesfrucht irgend eine der eurigen fremde, lebhafte Bewegung verspürt, infolge deren es in der Hüftgegend gribbelt, die Weichen erzittern, die ganze Bauchwandung Stösse fühlt und die Stelle der Last sich fortwährend ändert? Gewähren euch diese Bewegungen die sichere Gewissheit und vollkommene Sicherheit, weil ihr alsdann glaubet, das Kind lebe und spiele? Geratet ihr in Furcht, wenn die Unruhe der Frucht aufhört? Besitzt sie in euch bereits Gehör, denn sie schrickt bei ungewohntem Schall zusammen?“[24] „Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt“, erklärt Christus, „das habt ihr mir getan“[25]. Gott, der uns „vom Mutterschoß an getragen“[26], versichert uns: „Bis ihr grau seid, will ich euch tragen“[27].
[1] Jer 1,5. Alle Schriftzitate aus: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Neuauflage der Schöningh’schen Bibelübersetzung von 1936 (AT) bzw. 1946 (NT), aus den Grundtexten übersetzt und erläutert von P. Dr. Eugen Henne O. M. CAP. und P. Dr. Konstantin Rösch O. M. CAP., Bobingen 2022.
[2] Ps 139,15-16.
[3] Ijob 10,10-11.
[4] Ps 139,13.
[5] Ps 22,10-11.
[6] Convivium decem virginum 2,6; Bibliothek der Kirchenväter.
[7] Jes 44,2.
[8] Gen 9,5.
[9] Didache 2,2; Bibliothek der Kirchenväter.
[10] Epistula Barnabae 19,5; Bibliothek der Kirchenväter.
[11] Supplicatio pro Christianis 35; Bibliothek der Kirchenväter.
[12] Paidagogos 2,10,96,1; Bibliothek der Kirchenväter.
[13] Apologeticum 9; Bibliothek der Kirchenväter.
[14] Octavius 30,2; Bibliothek der Kirchenväter.
[15] Refutatio omnium haeresium 9,12; Bibliothek der Kirchenväter.
[16] Constitutiones Apostolorum 7,3; Bibliothek der Kirchenväter.
[17] Epistulae 57,2; Bibliothek der Kirchenväter.
[18] Epistulae 57,8; Bibliothek der Kirchenväter.
[19] Exameron 5,18,58; Bibliothek der Kirchenväter.
[20] In epistula ad Romanos commentarius 25,4; Bibliothek der Kirchenväter.
[21] Epistulae 2a,22,13; Bibliothek der Kirchenväter.
[22] Lk 1,41-42.
[23] Lk 1,43-44.
[24] De anima 25; Bibliothek der Kirchenväter.
[25] Mt 25,40.
[26] Jes 46,3.
[27] Jes 46,4.