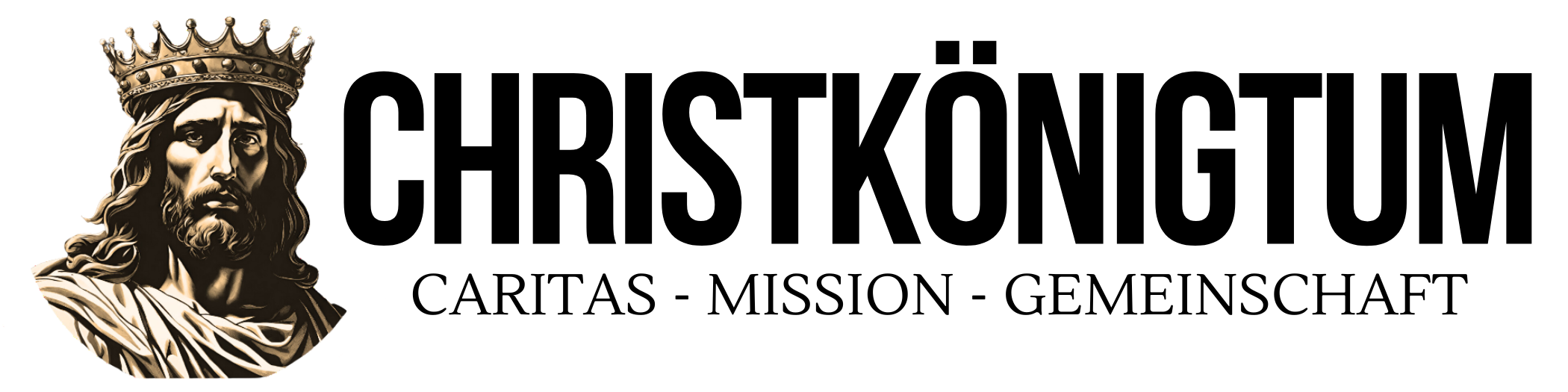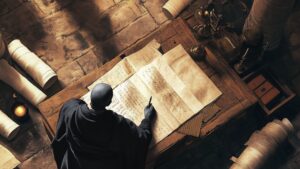Die katholische Kirche hat seit den Anfängen der Christenheit die Taufe der Kinder praktiziert. Diese Praxis ist keine spätere kirchliche Erfindung, sondern gründet tief im biblischen Offenbarungszeugnis. Die Taufe ist das neue Bundeszeichen, durch das der Mensch in die Gemeinschaft mit Christus aufgenommen wird. Wer diese Praxis bestreitet, wie es in manchen protestantischen Richtungen der Fall ist, verkennt die Einheit von Altem und Neuem Bund sowie die klare Lehre der Heiligen Schrift.
Der Bund im Alten Testament: Beschneidung auch der Kinder
Im Alten Bund war das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk die Beschneidung. Diese wurde nicht erst im Erwachsenenalter, sondern bereits an Säuglingen vollzogen:
Genesis 17,12: „Und jeder Knabe, der acht Tage alt ist, soll bei euch beschnitten werden, von Generation zu Generation, sowohl der im Haus Geborene als auch der für Geld von einem Fremden Gekaufte.“
Gott schließt seinen Bund nicht nur mit dem Einzelnen, sondern mit dem ganzen Haus, mit den Kindern und Nachkommen, die zum „Haus“ gehören. Die Zugehörigkeit zum Gottesvolk beginnt nicht erst mit einem persönlichen Glaubensakt des Kindes, sondern durch die Aufnahme in den Bund.
Die Taufe ist die christliche Beschneidung
Im Neuen Bund ersetzt die Taufe die Beschneidung als Bundeszeichen. Der Apostel Paulus schreibt:
Kolosser 2,11-12: „In ihm habt auch ihr die Beschneidung empfangen, allerdings nicht durch einen von Menschen vollzogenen Eingriff, sondern durch die christliche Beschneidung, das heißt durch das Ablegen des sterblichen Leibes. Mit ihm seid ihr in der Taufe begraben worden, mit ihm auch seid ihr auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.“
Paulus nennt ausdrücklich die Taufe die „christliche Beschneidung“. So wie im Alten Bund Säuglinge am achten Tag beschnitten wurden, so werden im Neuen Bund die Kinder durch die Taufe in die Heilsgemeinschaft eingefügt. Die Taufe ist kein rein symbolischer Akt, sondern ein wirksames Gnadenmittel, durch das der Mensch von der Erbsünde befreit und in den Leib Christi eingefügt wird. Im Neuen Testament wird mehrfach berichtet, dass ganze Häuser getauft wurden – eine Praxis, die die Aufnahme auch von Kindern einschließt.
Apostelgeschichte 16,31–33: „Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. […] Und er ließ sich sofort taufen, er und alle, die zu ihm gehörten.“
1. Korinther 1,16: „Auch das Haus des Stephanas habe ich getauft; sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe.“
Auch bei Lydia (Apg 16,14–15) wird berichtet, dass sie und ihr Haus getauft wurden.
Im biblischen Sprachgebrauch umfasst „Haus“ nicht nur Ehepartner, sondern die gesamte Familie einschließlich Kinder und Kleinkinder. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Kinder von der Taufe ausgeschlossen gewesen wären – vielmehr liegt das Gegenteil nahe.
Die Verheißung gilt auch den Kindern
Petrus verkündet am Pfingsttag:
Apostelgeschichte 2,38-39: „Kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird.“
Hier wird ausdrücklich gesagt, dass die Verheißung der Taufe auch den Kindern gilt. Es gibt keinen biblischen Hinweis, dass die Kinder erst in einem bestimmten Alter oder nach einer bewussten Bekehrung getauft werden sollten. Vielmehr sollen sie von Anfang an in den Bund Gottes aufgenommen werden, so wie es schon bei der Beschneidung war.
Antwort auf protestantische Einwände
Ein häufig vorgebrachter protestantischer Einwand lautet, dass der Glaube eine notwendige Voraussetzung für die Taufe sei und kleine Kinder nicht glauben könnten.
Doch im Alten Bund war der Glaube der Eltern ausreichend, um das Kind in den Bund aufzunehmen. Die Taufe ist vor allem ein Handeln Gottes, nicht des Menschen. Die Gnade Gottes ist nicht an das bewusste Verstehen des Täuflings gebunden. Der Glaube der Eltern und der Kirche tritt stellvertretend für das Kind ein – so wie auch Eltern für ihre Kinder beten, sie zum Glauben erziehen und Verantwortung übernehmen. Dazu verpflichten sich Eltern und Taufpaten bei der Taufe des Kindes.
Der hl. Augustinus schrieb treffend: „Die Kirche verleiht den Kindern durch den Glauben anderer den Glauben.“ (Sermo 176,2)
Die Kindertaufe steht in voller Kontinuität zwischen Altem und Neuem Bund. Im Alten Bund geschah die Beschneidung am achten Tag. Das war die Aufnahme des Kindes in den Bund. Im Neuen Bund ist dies die Taufe. Die Aufnahme des Kindes in den Leib Christi. Die biblischen Zeugnisse (1. Mose 17; Kol 2,11–12; Apg 2,38–39; Apg 16; 1 Kor 1,16) bestätigen die katholische Praxis eindeutig. Die Kindertaufe ist kein menschlicher Zusatz, sondern göttlicher Wille, der von der Kirche treu überliefert wurde.
Schließen wir diesen Beitrag mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus:
„Lasset die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht!“ (Markus 10,14).