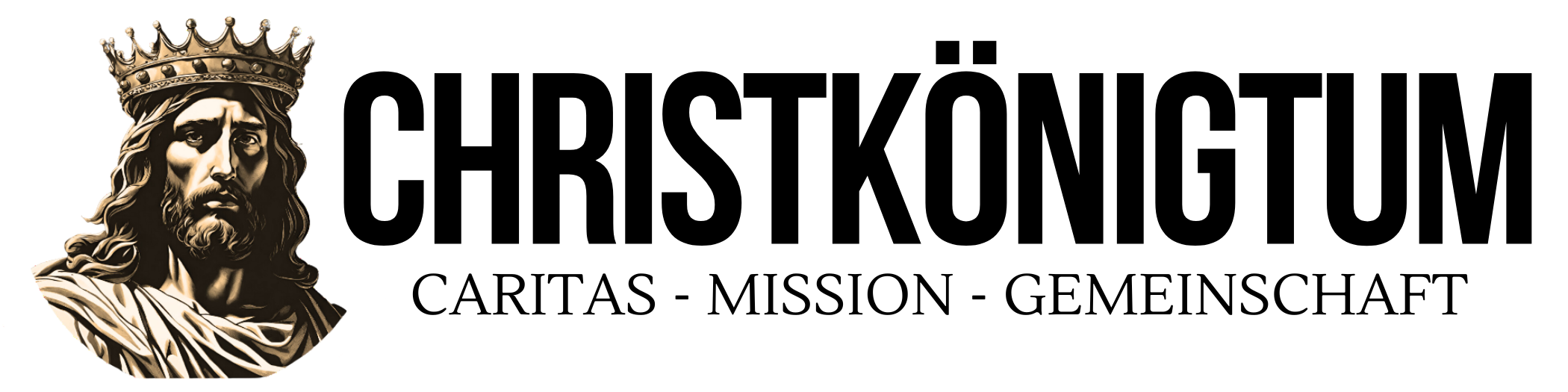Es war eine finstere Zeit. Über das Mittelmeer, einst die Wiege christlicher Kultur, legte sich der Schatten der Halbmondflagge. Schiffe, die vom Wind nach Westen trieben, liefen Gefahr, von den rasenden Galeeren der nordafrikanischen Korsaren überfallen zu werden. Ganze Dörfer an den Küsten Italiens, Spaniens und selbst Südfrankreichs wurden heimgesucht. Männer, Frauen und Kinder wurden fortgeschleppt – verkauft auf den Märkten von Algier, Tunis oder Tripolis.
Diese Christen, Söhne und Töchter der Kirche, verloren ihre Freiheit, oft ihre Familien – manchmal fast ihren Glauben.
Der Orden der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
In den Berichten jener Jahrhunderte – gesammelt in Archiven und Chroniken der Kirche – liest man von Hunderttausenden, die in Ketten lebten, in Gruben, auf Galeeren, unter der Sonne Nordafrikas. Manch einer trug die Narben der Peitsche, manch eine Mutter betete im Flüstern den Rosenkranz, während sie auf fremder Erde die Namen ihrer Kinder vergaß. Der Schmerz des Abendlandes war groß, und er schrie nach Antwort.
Und die Kirche antwortete.
Im Jahre des Herrn 1193 feierte in Paris ein junger Priester namens Johannes von Matha seine Primiz. Während der heiligen Messe, so berichtet die Überlieferung, sah er eine Erscheinung: Christus erschien ihm in Glanz, zwischen zwei Gefangenen – der eine weiß, der andere schwarz – mit Ketten an Händen und Füßen. Der Herr deutete ihm den Sinn: Er solle einen Orden gründen, der den Gefangenen die Freiheit bringe „zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit“.
So wurde der Orden der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Erlösung der Gefangenen geboren – kurz: die Trinitarier. Gemeinsam mit seinem Gefährten Felix von Valois zog Johannes nach Rom, wo Papst Innozenz III. im Jahre 1198 durch die Bulle Operante divinae dispositionis clementia die neue Gemeinschaft bestätigte.
Die Regel der Trinitarier war ebenso einfach wie heldenhaft:
Ein Drittel der Einkünfte für den Unterhalt der Brüder,
ein Drittel für die Armen,
und das letzte Drittel – für die Loskaufung der christlichen Gefangenen aus den Händen der Ungläubigen.
Und sie hielten Wort.
Unter Gebet und Fasten zogen Brüder in die Gefangenenlager von Algier, Tunis und Marokko, sammelten Lösegelder, verhandelten mit Händlern und Statthaltern. Sie überbrachten heimkehrenden Familienvätern das Geschenk der Freiheit – und oft trugen sie selbst Ketten, wenn die Mittel nicht ausreichten.
Chroniken berichten, dass allein in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens Zehntausende durch die Trinitarier erlöst wurden. Überall in Europa entstanden Häuser, von denen man zum Lösegeld sammelte – und Prozessionen, in denen die Heimgekehrten barfuß in die Kirchen einzogen, um vor dem Tabernakel das Te Deum zu singen.
Diese Arbeit war gefährlich, aber sie war getragen vom Glauben an die Dreifaltigkeit, die der Orden im Namen trug:
Gloria tibi, Trinitas – captivis libertas!
Die Mercedarier – Ritter Mariens für die Gefangenen
Kaum zwei Jahrzehnte später entflammte derselbe Geist in Spanien. Dort sah der Kaufmann Petrus Nolascus, bewegt von den Leiden seiner Landsleute unter maurischer Herrschaft, eine Vision der Gottesmutter Maria, die ihn bat, einen Orden zu gründen zur Befreiung der Gefangenen.
Unter dem Schutz des Königs Jakob I. von Aragón und auf Anraten des heiligen Raimund von Peñafort entstand im Jahr 1218 der Orden Unserer Lieben Frau von der Barmherzigkeit – die Mercedarier.
Papst Gregor IX. bestätigte ihn 1235.
Wie die Trinitarier zogen auch sie über das Meer, um Christen aus der Knechtschaft zu befreien. Doch ihre Hingabe ging noch weiter: Die Mercedarier legten ein viertes Gelübde ab – neben Armut, Keuschheit und Gehorsam:
„Ich verspreche, mich selbst hinzugeben, wenn es nötig ist, als Lösegeld für jene, die im Glauben Christi gefangen sind.“
Das war keine Metapher. Die Geschichte kennt viele Brüder, die ihr Gelübde mit Blut besiegelten.
Der heilige Raimund Nonnatus blieb in Algier als Geisel, als das Geld nicht reichte; er predigte den Mitgefangenen das Evangelium, bis man ihm den Mund mit einem Schloss verschloss.
Der heilige Serapion, ein Engländer im Dienste des Ordens, wurde von muslimischen Herren grausam hingerichtet, weil er die Gefangenen tröstete.
Papst Sixtus V. nannte sie später „wahre Ritter Christi und Mariens, deren Waffen das Gebet, deren Schild die Reinheit und deren Sieg die Erlösung der Seelen war“.
Der Schmerz und die Hoffnung
Die Lage der Christen, die in die Sklaverei gerieten, war erschütternd. Zeitgenössische Zeugnisse, etwa Briefe und Bittschriften, erzählen von Märkten, auf denen Menschen wie Vieh verkauft wurden, von Galeeren voller gefesselter Männer, die unter Peitschenhieben ruderten, und von Frauen, die in den Harems verschwanden.
Die islamischen Herrschaften Nordafrikas sahen in diesen Gefangenen Kriegsbeute oder Handelsware; ihre Freilassung war nur gegen hohe Summen zu erlangen. Viele Gefangene wurden mit Versprechungen und Drohungen zur Aufgabe des Glaubens gedrängt. So stand die Treue zu Christus oft auf dem Spiel.
Hier wuchs das Werk der Trinitarier und Mercedarier zur geistlichen Heldentat. Sie waren nicht nur Lösegeldzahler – sie waren Beichtväter, Tröster, Märtyrer. Inmitten der Gefangenenlager spendeten sie die Sakramente, richteten kleine Altäre auf, beteten mit den Verschleppten. Ihre Präsenz war wie eine Flamme im Dunkel des Unglaubens.
Papst Pius V., der Sieger von Lepanto, sah in ihnen die „lebendigen Werkzeuge der göttlichen Barmherzigkeit“. Und Benedikt XIV. schrieb später: „Was sie taten, war nicht bloß Almosen, sondern Nachfolge des Erlösers selbst, der sein Blut zum Lösegeld gab.“
Erbe und Vermächtnis
Durch Jahrhunderte hindurch – von der Reconquista bis in die Barockzeit – blieb das rote und blaue Kreuz der Trinitarier und das weiße Gewand der Mercedarier ein Zeichen der Hoffnung. In einer Welt, in der Christen von Feinden gefangen gehalten wurden, erhob sich die Kirche nicht mit Hass, sondern mit Taten der Barmherzigkeit.
Wenn heute Pilger die alte Kirche San Tommaso in Formis in Rom betreten, sehen sie über dem Portal das Mosaik: Christus zwischen zwei Gefangenen, die Hände verbunden – und über ihnen das Kreuz der Trinitarier. Es predigt stumm das Evangelium der Freiheit, das diese Orden lebten:
„Zur Ehre der heiligsten Dreifaltigkeit – den Gefangenen die Freiheit.“
So wurde aus dem Schmerz einer Zeit die Frucht einer Berufung.
Die Trinitarier und Mercedarier zeugen bis heute davon, dass die wahre Macht der Kirche nicht in Schwert und Kanone liegt, sondern in Gebet, Opfer und der Liebe, die in Ketten hinabsteigt, um Seelen zu retten.
Quellen:
The Catholic Encyclopedia (1907–1912)
The Trinitarian and Mercedarian Orders: a Study of Religious Redemptionism in the Thirteenth Century von James William Brodman
Ordens-Archivquellen der Mercedarier (Order of Mercy / Mercedarian Friars: Our History)