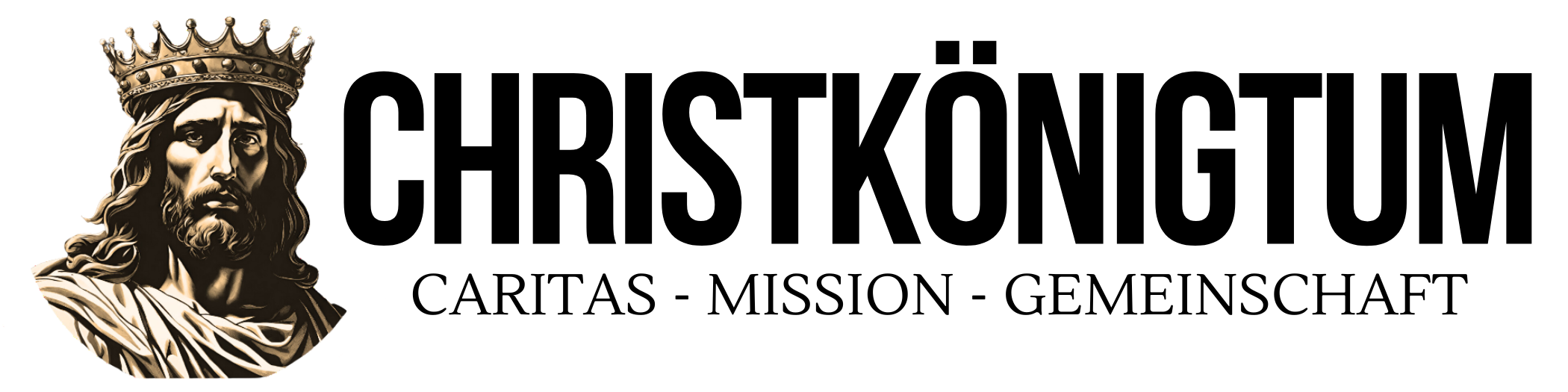Als das Frankenreich im 8. Jahrhundert durch innere Zwietracht geschwächt war, zog von Süden eine neue Gefahr herauf: der Islam, der seit 711 die Iberische Halbinsel unterworfen hatte. Seine Heere drangen in den folgenden Jahren wiederholt über die Pyrenäen, plünderten Städte und Heiligtümer und bedrohten die Grundlagen des christlichen Lebens in Gallien. In dieser Lage erhob sich ein Mann, der von der göttlichen Vorsehung berufen war, Europa zu verteidigen: Karl Martell.
Die Bedrohung durch den Islam
Die arabisch-berberischen Truppen unter ihren Feldherren überschritten ab 720 regelmäßig die Pyrenäen. Im Jahr 725 plünderten sie die Stadt Autun, deren Bischof Didier dabei den Märtyrertod erlitt. Schon diese Berichte zeigen, dass es nicht nur um Beute ging, sondern auch um einen Kampf gegen das Christentum selbst. Der Chronist Isidorus Pacensis, ein westgotischer Geistlicher, schrieb: „Ganz Hispania wurde vom Joch der Araber niedergetreten, und die Heiligenstätten Gottes wurden verwüstet.“
Als der Emir ʿAbd ar-Raḥmān im Jahr 732 mit einem großen Heer nach Gallien zog, stand die Abtei von Tours im Mittelpunkt seiner Pläne. Dort ruhte der heilige Martin, Bischof und Apostel Galliens. Wäre sein Grab geschändet worden, wäre dies für die Christenheit ein unermesslicher Schlag gewesen. Die Verteidigung des Heiligtums war daher mehr als Politik: sie war ein heiliger Auftrag.
Karl Martells Entscheidungsschlacht
Karl Martell, seit Jahren als Hausmeier der Merowinger der eigentliche Lenker des Frankenreiches, sammelte seine Gefolgsleute und zog den Feinden entgegen. In der Continuatio Hispana, einer zeitgenössischen Chronik, wird berichtet: „Karl, der mächtige Fürst der Franken, stellte sich ihnen entgegen wie eine unerschütterliche Mauer.“
Bei Tours und Poitiers kam es zur entscheidenden Schlacht. Tagelang standen sich die Heere gegenüber. Karl wählte die defensive Haltung: seine Truppen bildeten eine feste Phalanx, die selbst den stürmischen Angriffen der arabischen Reiterei standhielt. Der Chronist aus Saint-Denis vermerkte: „Die Franken standen wie ein Felsen, und Gott stärkte ihre Herzen.“
Der entscheidende Augenblick kam, als ʿAbd ar-Raḥmān selbst im Gefecht fiel. Ohne ihren Führer brach die Ordnung der muslimischen Truppen zusammen. In panikartiger Flucht zogen sie sich zurück, während Karl sein Heer diszipliniert hielt. Sein Sieg war vollkommen.
Der heilige Martin
Die fränkischen Annalen heben hervor, dass dieser Sieg nicht allein Menschenwerk war: „Karl kämpfte mit der Hilfe Christi, und der Herr zerstreute seine Feinde.“ Für die Christen war klar: Gott hatte sein Volk nicht verlassen, sondern einen Verteidiger gesandt.
Die Bedrohung der heiligen Stätte von Tours verlieh der Schlacht einen sakralen Charakter. Viele sahen im heiligen Martin selbst einen Fürsprecher, der durch seine Fürbitte den Sieg erwirkte. So schreibt eine spätere Chronik: „Nicht mit dem Schwert der Menschen, sondern mit der Hand des heiligen Martin wurden die Ungläubigen geschlagen.“
Damit wurde Karl Martell schon bald als malleus – der Hammer – bezeichnet, als Werkzeug Gottes gegen den Islam. Seine Taten schufen die Voraussetzung, dass das Abendland christlich blieb.
Folgen für Europa
Obgleich die islamische Herrschaft in Spanien bestehen blieb, endete mit Poitiers ihr Vormarsch nach Norden. Europa blieb christlich, die Kirche konnte in Gallien und darüber hinaus ihre Ordnung festigen. Der Papst in Rom, bedroht von den Langobarden, sah in den Karolingern die Schutzmacht der Christenheit. Auf Karls Fundament konnten sein Sohn Pippin und sein Enkel Karl der Große das Reich zur Größe führen und als defensor ecclesiae, Verteidiger der Kirche, wirken.
Karl Martells Vermächtnis
Karl starb am 22. Oktober 741 und wurde in der Basilika von Saint-Denis beigesetzt. Dort ruht er nicht als König, sondern als Held der Christenheit, der sein Leben ganz dem Schutz des Glaubens geweiht hatte.
Die katholische Kirche sieht in ihm den Mann, der Europa vor der Unterwerfung durch den Islam bewahrte. Seine Schlacht war mehr als ein Sieg auf dem Schlachtfeld – sie war die Rettung der abendländischen Christenheit. Noch Jahrhunderte später ehrten Mönche, Chronisten und Päpste sein Werk.
In Karl Martell vereinen sich die Züge eines Heerführers, Politikers und Glaubensverteidigers. Seine Taten zeugen von der Wahrheit des Psalmwortes: „Der Herr ist meine Stärke und mein Schild.“ (Ps 28,7). Er war der Hammer Gottes, der in der Stunde der Entscheidung das Abendland vor dem Ansturm des Islam bewahrte und den Weg für die christliche Kultur Europas ebnete.
Quellen:
Fränkische Quellen
Liber Historiae Francorum (um 727 verfasst)
Continuatio Chronicarum Fredegarii (Fortsetzung der Chronik des Fredegar, 8. Jahrhundert)
Annales Mettenses priores (um 800)
Annales regni Francorum (Annalen des Fränkischen Reiches, spätes 8. Jahrhundert)