In einer Zeit des religiösen Pluralismus und der wachsenden Popularität fernöstlicher Spiritualität sehen sich Katholiken oft mit der Frage konfrontiert, ob der Buddhismus eine wahre Religion sein könnte. Besonders in westlichen Gesellschaften wird der Buddhismus häufig als eine friedliche und tiefgründige Lebensphilosophie dargestellt, die sich scheinbar gut mit dem Christentum vereinen ließe. Doch aus katholischer Sicht kann der Buddhismus nicht die wahre Religion sein, da er fundamentalen christlichen Wahrheiten widerspricht und das Heil nicht vermittelt.
Eine Analyse
Dieser Artikel wird aus katholischer Perspektive darlegen, warum der Buddhismus keine wahre Religion ist. Wir werden dabei seine metaphysischen Annahmen, seine Heilslehre, seine Auffassung von Gott und die Konsequenzen seiner Lehren mit der katholischen Lehre vergleichen:
Das Fehlen eines personalen Gottes
Der katholische Glaube: Der eine, wahre Gott.
Das Christentum basiert auf der Offenbarung des einen wahren Gottes, der sich in der Heiligen Schrift und durch Jesus Christus selbst geoffenbart hat. Gott ist kein unpersönliches Prinzip, sondern ein dreifaltiger Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt erschaffen, erhält sie in Existenz und lenkt sie nach seinem göttlichen Willen.
Der Buddhismus: Kein persönlicher Gott
Im Gegensatz dazu kennt der Buddhismus keinen personalen Gott, der Schöpfer und Herrscher des Universums ist. Gautama Buddha lehrte keinen Monotheismus, sondern eine kosmische Ordnung, in der Götter – falls sie überhaupt anerkannt werden – als vergängliche Wesen betrachtet werden, die selbst dem Kreislauf der Wiedergeburten unterworfen sind.
In der katholischen Tradition ist das Fehlen eines personalen Gottes ein entscheidendes Merkmal falscher Religionen. Die Heilige Schrift bezeugt, dass es außerhalb der Offenbarung Gottes nur Täuschung oder menschliche Spekulation gibt (vgl. Jesaja 44,6–20). Da der Buddhismus nicht nur den wahren Gott nicht anerkennt, sondern in vielen seiner Schulen sogar die Vorstellung einer letzten metaphysischen Realität (wie das Nirvana) als unpersönlich und letztlich unbegreiflich ansieht, kann er keine wahre Religion sein.
Eine fehlerhafte Sicht auf das Heil
Die katholische Sicht: Heil durch Jesus Christus
Nach katholischer Lehre ist das Heil allein durch Jesus Christus möglich:
“Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.” (Johannes 14,6)
Das Heil bedeutet ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das durch Gnade, Glauben und gute Werke erlangt wird. Der Mensch wurde nach dem Sündenfall von Gott entfremdet, doch durch das Opfer Jesu am Kreuz wurde ihm die Möglichkeit zur Erlösung geschenkt.
Die buddhistische Sicht: Nirvana und Selbsterlösung
Der Buddhismus kennt keinen Erlöser, der den Menschen rettet, sondern lehrt, dass jeder Mensch durch eigene Anstrengung die Erleuchtung erlangen muss. Das höchste Ziel ist das Nirvana, das oft als Auflösung des individuellen Selbst interpretiert wird. Anstatt die persönliche Gemeinschaft mit Gott zu suchen, strebt der Buddhist nach der Überwindung aller Begierden und schließlich nach dem „Erlöschen“ der individuellen Existenz.
Dies widerspricht direkt der katholischen Auffassung vom Heil, die eine ewige, bewusste Glückseligkeit mit Gott vorsieht. Der katholische Glaube lehrt, dass der Mensch für eine Beziehung mit Gott geschaffen wurde und dass jede andere Form des Heils letztlich eine Illusion ist.
Die falsche Anthropologie des Buddhismus
Die katholische Lehre: Der Mensch als Ebenbild Gottes
Nach der katholischen Lehre ist der Mensch nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen (vgl. Genesis 1,27). Er hat eine unsterbliche Seele, die nach der körperlichen Auferstehung entweder zur ewigen Seligkeit oder zur ewigen Verdammnis gelangt.
Der Buddhismus: Der Mensch als vergängliches Aggregat
Der Buddhismus hingegen lehrt, dass es kein dauerhaftes Selbst gibt (Anatta-Lehre). Das, was wir als „Ich“ bezeichnen, ist nur ein Bündel von Sinneseindrücken und geistigen Prozessen, die nach dem Tod zerfallen oder sich in einer anderen Existenzform wieder zusammenfügen.
Diese Auffassung widerspricht fundamental der katholischen Lehre. Wenn es kein wirkliches, individuelles Selbst gibt, dann gibt es auch keine persönliche Verantwortung, keine persönliche Beziehung zu Gott und keine ewige Glückseligkeit in der Anschauung Gottes. Die christliche Lehre betont dagegen, dass jeder Mensch eine unersetzbare, von Gott geliebte Seele hat, die nach dem Tod entweder in die ewige Gemeinschaft mit Gott eintritt oder durch ewige Trennung von ihm leidet.
Die moralischen Konsequenzen des Buddhismus
Die katholische Moral: Göttliches Gesetz und objektive Wahrheit
Die katholische Moral ist auf Gottes Gesetz gegründet. Die Zehn Gebote und die Lehren Christi sind für alle Menschen verbindlich und offenbaren die objektive Wahrheit über das Gute und das Böse.
Der Buddhismus: Relativismus und ethische Pragmatik
Obwohl der Buddhismus einige moralische Prinzipien wie Gewaltlosigkeit und Mitgefühl betont, fehlt ihm ein absolutes moralisches Gesetz, das von einem göttlichen Gesetzgeber stammt. Die buddhistische Ethik ist oft utilitaristisch, das heißt, sie orientiert sich an dem, was zur „Erleuchtung“ führt, anstatt an einer objektiven Wahrheit.
Diese Relativierung des moralischen Gesetzes ist aus katholischer Sicht höchst problematisch, da sie die Sündhaftigkeit des Menschen und seine Verantwortung vor Gott verwischt. Ohne eine objektive Moral gibt es letztlich keine absolute Verpflichtung, das Gute zu tun und das Böse zu meiden.
Die Unvereinbarkeit mit der katholischen Mission
Der katholische Glaube ist von Natur aus missionarisch. Christus selbst befahl seinen Jüngern:
“Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!” (Markus 16,15)
Der Buddhismus hingegen sieht keine Notwendigkeit, die „Wahrheit“ zu verkünden, sondern betrachtet Religion oft als eine persönliche Meditationspraxis. Dies widerspricht dem katholischen Sendungsbewusstsein, das darauf beruht, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist.
Der Buddhismus kann aus katholischer Sicht nicht die wahre Religion sein, weil er:
1. Gott verleugnet und keinen Schöpfer anerkennt.
2. Kein wahres Heil bietet, da er keine Erlösung durch Christus kennt.
3. Eine falsche Anthropologie vertritt, indem er das Selbst leugnet.
4. Keine objektive Moral hat, sondern ethischen Relativismus fördert.
5. Mit der christlichen Mission unvereinbar ist, da er keine absolute Wahrheit beansprucht.
Während der Buddhismus in seiner äußeren Form friedlich und tiefgründig erscheinen mag, führt er letztlich nicht zur Wahrheit, sondern entfernt die Seelen von Gott. Katholiken sollten sich daher nicht von der scheinbaren Weisheit buddhistischer Lehren verführen lassen, sondern in der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche bleiben, die allein das Heil in Jesus Christus vermittelt.
Gewalt im Buddhismus
Die verschiedenen Strömungen des Buddhismus und ihre problematischen Aspekte
Während viele Menschen den Buddhismus als eine friedliche, einheitliche Religion betrachten, ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall. Der Buddhismus hat sich über Jahrhunderte in verschiedene Strömungen aufgespalten, die sich in Lehre, Praxis und Ethik erheblich unterscheiden. Einige dieser Richtungen haben sogar eine gewaltsame Geschichte, die dem verbreiteten Klischee eines „friedlichen Buddhismus“ widerspricht.
Die drei Hauptströmungen des Buddhismus
Theravāda-Buddhismus (Südostasien)
Diese älteste Form des Buddhismus ist in Ländern wie Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Laos und Kambodscha verbreitet. Der Theravāda-Buddhismus betont die persönliche Meditation und die Befolgung der „Vier Edlen Wahrheiten“ sowie des „Achtfachen Pfades“. Er gilt als relativ konservativ und sieht die Erleuchtung nur für Mönche als realistisch an.
Problematisch aus katholischer Sicht:
– Ablehnung eines persönlichen Gottes
– Leugnung der Existenz einer unsterblichen Seele
Mahayāna-Buddhismus (China, Japan, Korea, Vietnam)
Diese Richtung des Buddhismus entstand etwa 500 Jahre nach Buddha und erweiterte den ursprünglichen Buddhismus um zahlreiche neue Konzepte, darunter den Glauben an „Bodhisattvas“ – erleuchtete Wesen, die anderen helfen sollen, Erlösung zu erlangen. Zen-Buddhismus, Reines-Land-Buddhismus und tibetischer Buddhismus sind Mahayana-Abspaltungen.
Problematisch aus katholischer Sicht:
– Götzenverehrung durch Anbetung von Bodhisattvas
– Einflüsse aus dem Schamanismus und Okkultismus
– Keine klare moralische Lehre, sondern eher spirituelle Techniken zur „Erleuchtung“
Vajrayāna-Buddhismus (Tibet, Mongolei, Bhutan)
Diese esoterische Form des Buddhismus, auch als „Tibetischer Buddhismus“ bekannt, integriert tantrische Rituale, Mantras und magische Praktiken. Der Dalai Lama ist der bekannteste Vertreter.
Problematisch aus katholischer Sicht:
– Verwendung von Magie und okkulten Praktiken
– Sexuelle Rituale im tantrischen Buddhismus
– Eine Priesterkaste mit quasi-göttlichem Status
Die gewalttätige Seite des Buddhismus
Obwohl der Buddhismus oft als eine „friedliche“ Religion angesehen wird, gibt es viele historische und moderne Beispiele für Gewalt im Namen des Buddhismus.
Buddhistische Kriege in der Geschichte
– Japanische Samurai und der Zen-Buddhismus: Im mittelalterlichen Japan rechtfertigten Zen-Mönche die Gewalt der Samurai und sahen das Töten im Krieg als spirituelle Übung an.
– Buddhistische Kämpfer in Tibet: Tibetische Mönchsorden führten jahrhundertelang gewaltsame Machtkämpfe, besonders zwischen der Gelugpa- und der Kagyü-Schule.
– Buddhistische Aufstände in China: In der Tang-Dynastie kam es zu bewaffneten buddhistischen Revolten.
Moderne buddhistische Gewalt
Myanmar (Burma): Nationalistische buddhistische Gruppen, wie die radikale „969-Bewegung“, haben in den letzten Jahren ethnische Säuberungen gegen Christen verübt.
Sri Lanka: Die Singalesisch-buddhistische Mehrheit führte einen brutalen Bürgerkrieg gegen die Tamilen, unterstützt von buddhistischen Mönchen.
Thailand: In den südlichen Provinzen gibt es immer wieder Angriffe buddhistischer Gruppen auf Minderheiten.
Diese Beispiele zeigen, dass der Buddhismus keineswegs immer friedlich ist. Gewalt entsteht überall dort, wo Menschen Irrlehren anhängen und sich von der Wahrheit Gottes entfernen. Der Buddhismus ist nicht nur inhaltlich unvereinbar mit dem katholischen Glauben, sondern hat auch in vielen seiner Strömungen problematische und gewalttätige Elemente. Die Vorstellung, dass der Buddhismus eine rein friedliche und harmonische Religion sei, ist ein moderner Mythos, der einer kritischen Prüfung nicht standhält. Katholiken sollten daher den Buddhismus nicht als eine harmlose oder gar ergänzende Lehre betrachten, sondern erkennen, dass er die Menschen von der einen wahren Religion – dem katholischen Glauben – fernhält.
Warum der Buddhismus Götzendienst ist
Die katholische Kirche lehrt, dass es nur einen wahren Gott gibt: den dreifaltigen Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jede Religion oder Praxis, die sich von diesem einen wahren Gott abwendet und sich stattdessen auf Götzen, falsche Götter oder übernatürliche Mächte stützt, fällt unter das biblische Verbot des Götzendienstes.
Buddhismus und der Götzendienst
Der Buddhismus, obwohl er in seiner ursprünglichen Form nicht von einem persönlichen Gott spricht, ist dennoch tief in Götzendienst verstrickt. In diesem Artikel werden wir genau untersuchen, warum der Buddhismus als eine Form des Götzendienstes betrachtet werden muss, selbst wenn viele westliche Menschen ihn lediglich als „Philosophie“ oder „Lebensweise“ ansehen.
Die katholische Definition von Götzendienst
Biblische Grundlage
Götzendienst wird in der Bibel als eine der schwersten Sünden betrachtet. Gott selbst verbietet ihn eindeutig in den Zehn Geboten:
„Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen (…) Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!“ (Exodus 20,3-5)
Der heilige Paulus warnt ebenfalls vor Götzendienst und erklärt, dass hinter falschen Göttern in Wirklichkeit Dämonen stehen:
„Was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich aber will nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt.“ (1. Korinther 10,20)
Was ist Götzendienst?
Nach katholischer Lehre ist Götzendienst nicht nur die Verehrung von Statuen, sondern jede Form der Anbetung oder übernatürlichen Verehrung, die nicht dem einen wahren Gott gewidmet ist. Dazu gehören:
Direkte Anbetung von falschen Göttern oder Geistern
Okkultismus und spirituelle Praktiken, die nicht auf Gott ausgerichtet sind
Übermäßige Verehrung von menschlichen Wesen, Heiligen oder sogar sich selbst als eine Art Gott
Wie der Buddhismus Götzendienst begeht
Obwohl der ursprüngliche Buddhismus (Theravāda) keine direkte Vorstellung eines Schöpfergottes hat, sind fast alle buddhistischen Strömungen voller götzendienerischer Praktiken.
Anbetung von Buddha als eine göttliche Figur
In vielen buddhistischen Traditionen wird Gautama Buddha nicht nur als Lehrer verehrt, sondern als eine quasi-göttliche Figur. Millionen von Buddhisten beten Buddha-Statuen an, bringen Opfer dar und erwarten von ihnen Schutz und spirituelle Segnungen. In Ländern wie Thailand, China, Japan und Tibet sieht man täglich, wie Gläubige Räucherstäbchen vor Buddha-Statuen anzünden, vor ihnen niederknien und sie anflehen.
Warum ist das Götzendienst?
– Buddha war ein sterblicher Mensch, kein Gott.
– Die Anbetung eines Geschöpfes statt des Schöpfers ist Götzendienst.
– Diese Praxis ersetzt das Gebet zu Gott durch das Gebet an eine menschliche Figur.
Verehrung von Bodhisattvas und „buddhistischen Heiligen“
Im Mahāyāna-Buddhismus (China, Japan, Tibet) gibt es eine Vielzahl von übernatürlichen Figuren, die verehrt werden. Dazu gehören:
– Avalokiteshvara (Guanyin): Wird als barmherziger Retter angesehen und um Schutz und Glück gebeten.
– Ksitigarbha: Soll die Seelen aus der Hölle retten.
– Amitabha Buddha: Ein transzendenter Buddha, der den Gläubigen ins „Reine Land“ führen soll.
Diese Verehrung hat nichts mit der katholischen Heiligenverehrung zu tun, denn Heilige werden im Christentum nicht angebetet, sondern nur als Fürsprecher angerufen. Die buddhistische Praxis ist jedoch echte Anbetung mit Opfern, Gebeten und Tempelritualen.
Warum ist das Götzendienst?
– Es handelt sich um die Verehrung erschaffener Wesen anstelle Gottes.
– Buddhisten erwarten göttliche Hilfe von diesen Geistern.
– Manche Buddhisten glauben, dass sie selbst durch Gebete an Bodhisattvas spirituelle Kraft erlangen.
Okkultismus und magische Praktiken im Buddhismus
Besonders im Vajrayāna-Buddhismus (tibetischer Buddhismus) sind magische Rituale, Mantras und esoterische Praktiken weit verbreitet. Viele Praktiken ähneln dämonischen Ritualen:
Mantras und Zaubersprüche: Mantras sind heilige Silben oder Verse, die rezitiert werden, um spirituelle Macht zu erlangen.
Mandalas und tantrische Rituale: Einige tibetische Praktiken beinhalten geheime Zeremonien, um Erleuchtung oder weltliche Vorteile zu erhalten.
Besessenheit durch Geister: Es gibt Rituale, bei denen buddhistische Mönche sich absichtlich von Geistern „besetzen“ lassen, um Prophezeiungen zu erhalten.
Warum ist das Götzendienst?
– Diese Praktiken sind dem Okkultismus und der Zauberei ähnlich, die von der Bibel strikt verboten werden (vgl. Deuteronomium 18,10-12).
– Sie rufen Geister an, die keine göttlichen Wesen, sondern wenn überhaupt Dämonen sind .
– Der tibetische Buddhismus glaubt an zahlreiche Götter und Dämonen, die verehrt oder beschwichtigt werden müssen.
Spirituelle Gefahren des Buddhismus aus katholischer Sicht
Die Anbetung eines falschen Gottes führt zur Täuschung
Jeder Mensch hat ein tiefes Bedürfnis, Gott zu verehren. Wenn dieses Bedürfnis nicht dem einen wahren Gott gewidmet wird, fällt der Mensch leicht in falsche Anbetung.
Der Buddhismus ersetzt die Anbetung Gottes durch:
– Die Anbetung von Buddha oder Bodhisattvas
– Die Suche nach „Selbsterleuchtung“ statt nach Gottes Wahrheit
– Die Beschäftigung mit Magie, Mantras und spirituellen Kräften
Dämonische Einflüsse im Buddhismus
Nach der katholischen Tradition stehen hinter falschen Göttern oft dämonische Mächte. Das erklärt auch, warum viele buddhistische Praktiken mit spirituellen Phänomenen verbunden sind – Visionen, Besessenheit, Spukerscheinungen und paranormale Erfahrungen. In Ländern mit starkem Buddhismus sind dämonische Besessenheit und okkulte Praktiken weit verbreitet. Missionare berichten von vielen Fällen, in denen Menschen, die sich mit Buddhismus oder esoterischen Praktiken beschäftigten, spirituelle Bedrängnis oder dämonische Angriffe erlebten.
Der Buddhismus mag im Westen oft als „harmlose Weisheitslehre“ erscheinen, doch in Wahrheit ist er voller Götzendienst. Er ersetzt die wahre Anbetung des dreifaltigen Gottes durch:
– Die Anbetung von Buddha-Statuen
– Die Verehrung von Bodhisattvas und übernatürlichen Wesen
– Okkulte und esoterische Praktiken
Aus katholischer Sicht führt dies nicht nur von Gott weg, sondern öffnet Türen für dämonische Einflüsse. Jeder Katholik sollte sich daher bewusst sein, dass der Buddhismus eine falsche Religion ist, die in den Götzendienst führt – eine der schwersten Sünden gegen Gott. Die einzig wahre Anbetung ist die Anbetung Gottes in der katholischen Kirche. Wie es in den Psalmen heißt:
„Alle Götzen der Völker sind Dämonen, aber der Herr hat die Himmel geschaffen.“
Psalm 96,5
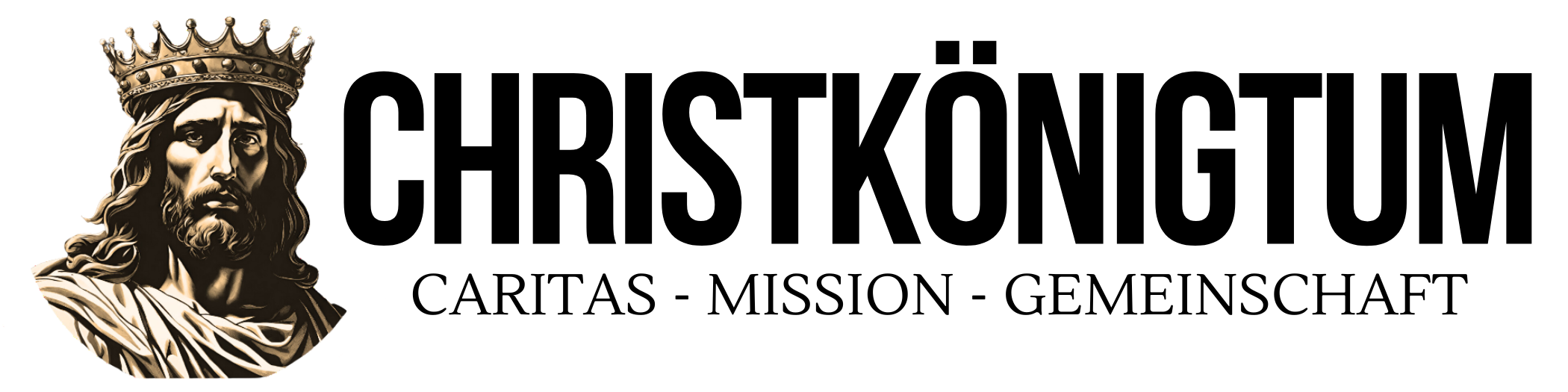


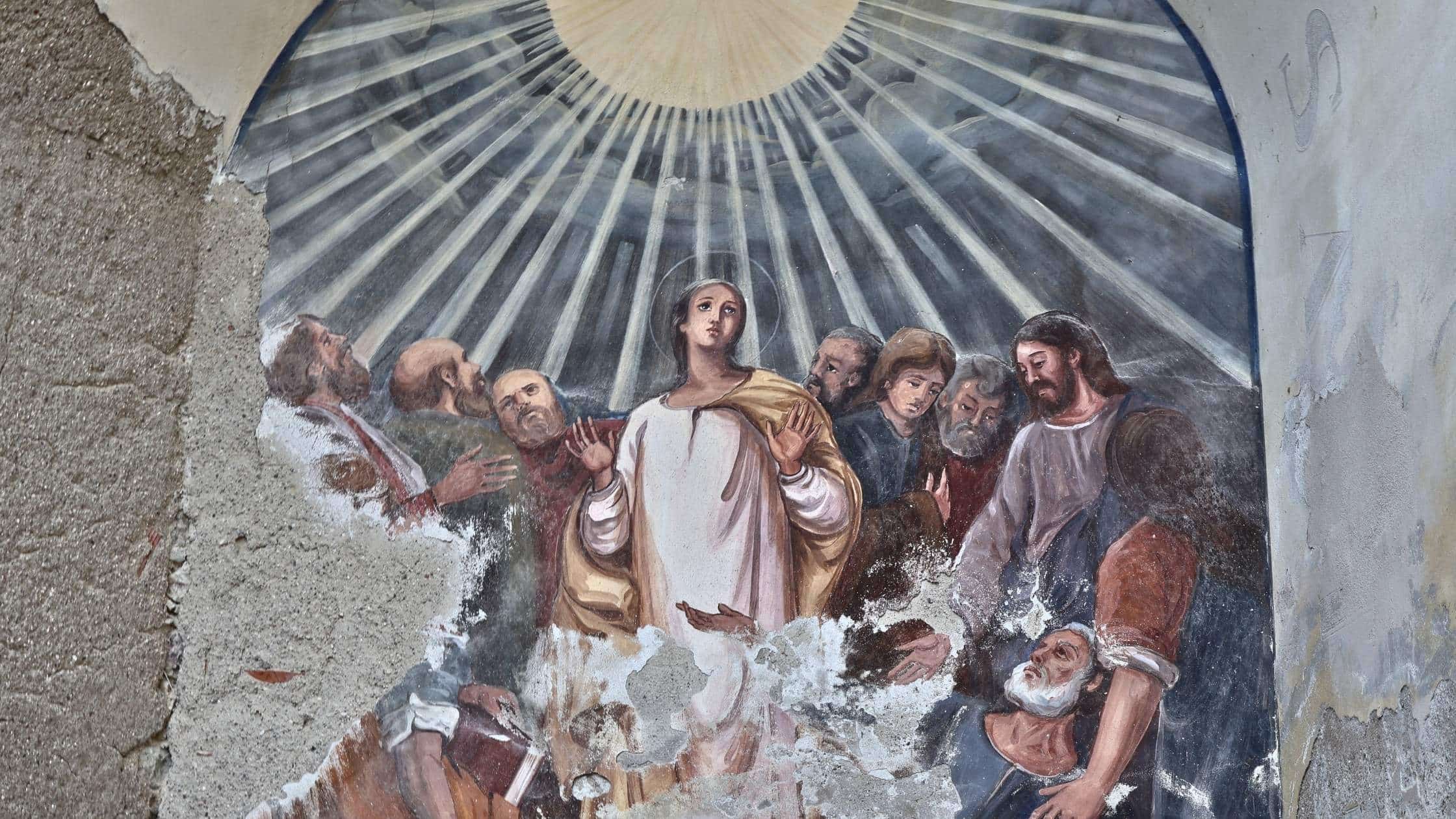



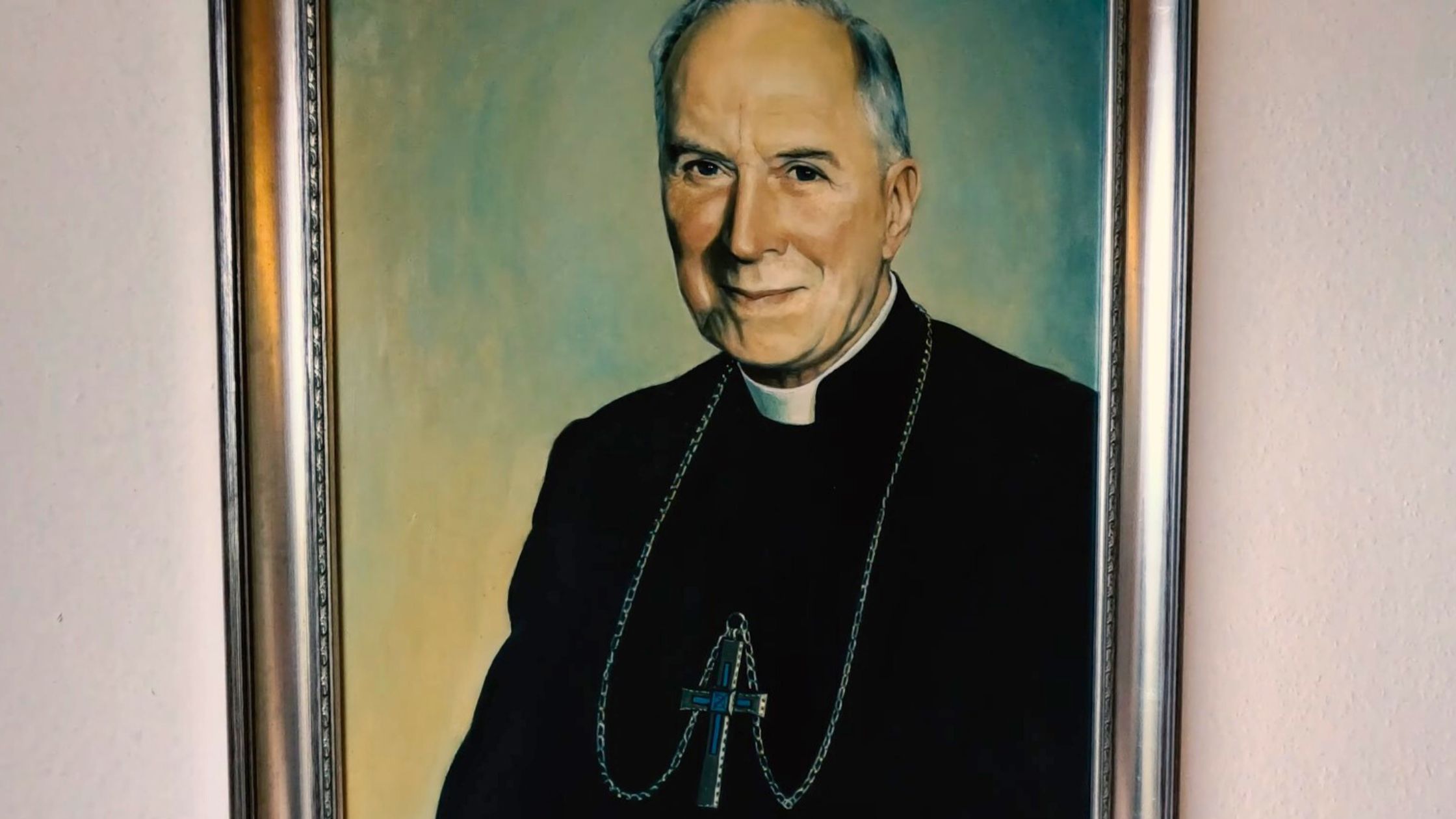


3 Antworten
Vielen Dank für diesen informativen Artikel.
Sehr wichtig diese Aufklärung!!!!!
Es gibt zum Dalai Lama – tibetischer Buddhismus – auch ein aufschlussreiches Buch: Das Lächeln des Dalai Lama .. darüber wird aber im Westen natürlich geschwiegen … wie überhaupt diese dämonische Seite des Buddhismus und ebenso dessen Frauenfeindlichkeit …
Es waren im Übrigen Frauen, wie H.P. Blavatsky, die das östliche Denken nach dem Westen gebracht haben, oder Elisabeth Haich .. der dritte Name fällt mir nicht mehr ein .. eine Frau, deren Leben beschrieben wurde, die als erster westlicher Mensch nach Tibet eingelassen wurde, und bei der ich damals zum ersten Mal über aufgestiegene Meister etcpp gelesen habe.
Ich habs:
https://www.geschichte.fm/archiv/gag445/
Alexandra David-Néel
Eine Frage:
Könnte mir jemand helfen, diese Sache mit der “Blume des Lebens” zu durchleuchten, von Drunvalo Melchizedek, “heilige” Geometrie usw?
Bzw vielleicht mal einen Artikel dazu bringen, wenn es die Zeit erlaubt?
Danke im Voraus, falls …
Sehr gut zusammengefasst, scheint mir. Doch zu einem Punkt habe ich einen Einwand: in der Aufzählung am Anfang als Gründe, die gegen den Buddhismus sprechen, heißt es:
“5. Mit der christlichen Mission unvereinbar ist, da er keine absolute Wahrheit beansprucht.”
in gewisser Weise beansprucht der Buddhismus sehr wohl eine Wahrheit, nämlich seine eigene. Und wie wissen, dass diese Bewegung sehr stark missioniert. Es gibt weltweit zahlreiche Versammlungszentren, z.B. im Allgäu, aber auch in kleineren Städten, so ähnlich weit verbreitet wie früher die Kirche im Dorf.
Es werden stetig, mit finanzieller Unterstützung westlicher Gönner, Stupas, also Denkmale zur Verehrung der Buddhanatur errichtet, die uns als “Wohlmeinende Verbreitung positiver Energien” verkauft werden. An auch touristisch und regionalhistorisch bedeutenden Orten stehen diese Götzendenkmäler, auch in der Schweiz z.B. am Säntis und besonders viele offenbar in Österreich, zum Beispiel rund um/in Graz. Sie enthalten Reliquien und sollen “positive Energien” verbreiten, gemäß ihren magischen Praktiken. Diese “Energien”, die buddhistischen Götzendienst und Selbsterlösungspraktiken (“Karma”) zur Grundlage haben, werden auf diese Weise in einer Welt verbreitet, die, selbst gottlos geworden, diesen Kräften nichts entgegenzusetzen hat, vielmehr sich durch seine Inhaltsleere keicht von anderen “besetzen” lässt.
Und es werden immer mehr buddhistische aZentren und Denkmäler, unaufhaltsam. So nimmt der Buddhismus immer mehr Gebiete weltweit ein und verbreitet die “buddhistische Wahrheit” stark missionarisch. Diese Besitznahme geschieht, anders als bei anderen Religionen, weitgehend unbemerkt und “vollkommen friedlich”, was viele begeisterte und kaum jemanden misstrauisch werden lässt.
Vielleicht interessiert es einmal jemanden auf einer Karte darzustellen, wo diese Stupas schon überall stehen. Es ist nicht so einfach, zuverlässige Informationen darüber zu erhalten.
Sehr geehrte Frau Claudia L.
Als jahrzehnter lang Praktizierender der Lehre des Buddhas möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihren Beitrag. Warum? Weil Sie mitteilen, dass Sie sich Sorgen machen wegen des Erscheinen der Lehre des Buddhas in der westlichen Welt. Vor ca. 2900 Jahren kam diese Lehre in die Welt, wie wir diese kennen. Es wurde vorausgesagt, das diese fünf 500 Jahres Zyklen bestehen bleiben würde. Diese Zeit ist schon einige Jahrhunderte vorbei. Vieles was als Buddhismus erscheint ist nichts anders als ein “christliches” Glauben in einem buddhistischen Mantel. (Wobei es natürlich nicht wirklich christlich ist, aber diese Menschen diese Grundhaltung beibehalten haben.) Wie sagte der Dalai Lama zu seinem deutschen Übersetzer: “Sie werden sich auch wieder bekreuzigen.” Die Lehre des Buddhas ist keine Religion, wie viele dies vertreten. Machen Sie sich keine Sorgen um die Stupas, sie werden Ihnen nicht schaden. Die Lehre des Buddhas ist dem Untergang geweiht, sie wird zerstört, aber nicht von Christen, Muslimen, Juden, Atheisten, Diktaturen, sie wird von den sogenannten Buddhisten selbst zerstört. Ihnen als Katholikin lege ich ans Herz, haben Sie bitte ein eingerichtetes Vertrauen in Jesu und Maria, sie werden immer bei Ihnen sein.