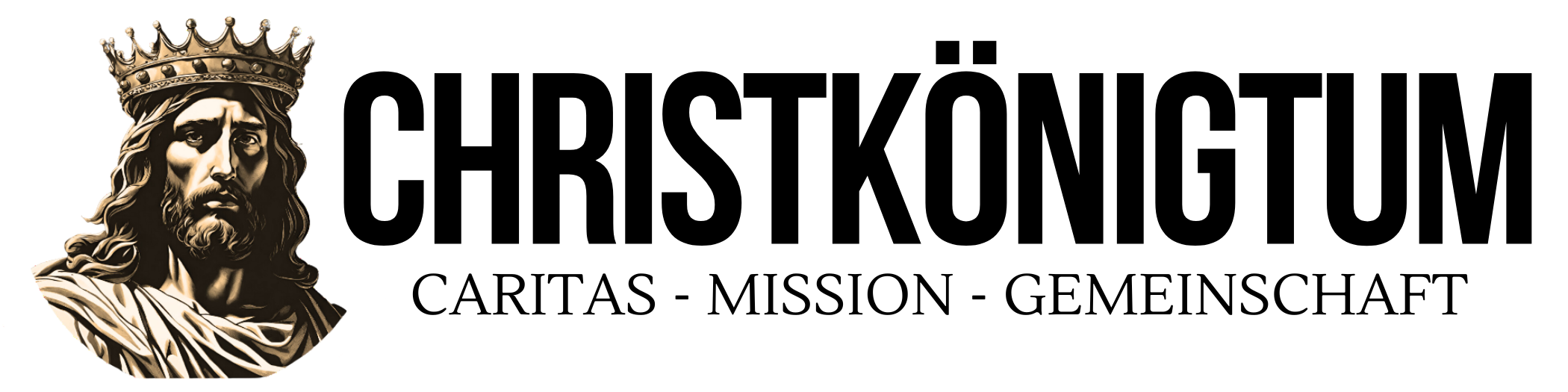Seit knapp zwei Jahrtausenden feiert die Kirche mit heiliger Freude das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus am 25. Dezember. Während die festliche Liturgie, das feierliche „Adeste fideles“ und die nächtliche Christmette eine tiefe und ergreifende Wirklichkeit bezeugen, wird dieses Datum in modernen Kreisen zunehmend als bloß symbolisch oder gar als heidnischer Kompromiss abgetan. Man hört oft die Behauptung, der 25. Dezember sei vom Fest des „Sol Invictus“, dem unbesiegbaren Sonnengott, übernommen worden. Doch eine nähere und zugleich ehrfürchtige Untersuchung der Zeugnisse der Kirchenväter, der biblischen Chronologie und der liturgischen Entwicklung zeigt: Der 25. Dezember ist keineswegs ein zufälliges Datum – er hat tiefe Wurzeln in der christlichen Überlieferung und könnte sehr wohl der tatsächliche Geburtstag unseres göttlichen Erlösers sein.
Die frühchristliche Tradition: Zeugnisse der Kirchenväter
Bereits im frühen 3. Jahrhundert finden wir bemerkenswerte Hinweise auf den 25. Dezember als Geburtsdatum Jesu. Einer der ältesten und bedeutendsten Belege stammt vom heiligen Hippolyt von Rom (ca. 170–235). In seinem „Kommentar zum Buch Daniel“, geschrieben um das Jahr 204, sagt Hippolyt unmissverständlich:
„Denn das erste Kommen unseres Herrn, das im Fleisch war, geschah in Bethlehem, am 25. Dezember, am Mittwoch …“
Diese präzise Angabe verdient besondere Beachtung. Sie wurde rund 70 Jahre vor der offiziellen Einführung des Sol-Invictus-Festes durch Kaiser Aurelian im Jahr 274 n. Chr. geschrieben – zu einer Zeit, in der Christen nicht nur keinen kulturellen oder politischen Anlass hatten, ein heidnisches Datum zu imitieren, sondern sich im Gegenteil bewusst abgrenzten. Hippolyts Aussage steht somit nicht im Kontext einer heidnischen Überlagerung, sondern als früheste schriftliche christliche Festlegung des Weihnachtsdatums.
Ein weiteres gewichtige Zeugnis stammt vom heiligen Johannes Chrysostomus (ca. 347–407), einem der größten Kirchenväter des Ostens. In einer seiner Weihnachts-Homilien erklärt er:
„Aber auch der 25. Dezember ist kein willkürlich gewählter Tag. […] Vom Tempeldienst des Zacharias kann man den Empfängnistermin der Elisabeth berechnen. Daraus folgt, dass die Geburt Christi mit Recht auf den 25. Dezember fällt.“
Chrysostomus verteidigt nicht nur das Datum gegen mögliche Einwände, sondern legt eine chronologische Argumentation aus der Heiligen Schrift vor, die wir im Folgenden betrachten wollen.
Die biblisch-chronologische Herleitung: Lukas, Zacharias und der jüdische Tempelkalender
Das erste Kapitel des Lukasevangeliums berichtet von der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers an Zacharias, einen Priester, der „nach der Ordnung Abija“ im Tempel diente (Lk 1,5). Diese „Ordnung Abija“ war die achte von 24 Priesterklassen, die gemäß 1. Chronik 24:10 im jährlichen Tempeldienst ihren Dienst versahen.
Beginnend mit dem jüdischen Jahr im Monat Nissan (März/April), ergibt sich, dass die Abteilung Abija ungefähr Mitte Juni ihren Dienst verrichtete. Es ist genau in dieser Zeit, dass Zacharias im Tempel dem Engel Gabriel begegnete, der ihm die Geburt seines Sohnes ankündigte. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth – und der Evangelist berichtet, dass sie sich fünf Monate lang verborgen hielt.
Als dann Gabriel zu Maria nach Nazareth gesandt wird, um ihr die Geburt des Messias zu verkünden, ist Elisabeth bereits „im sechsten Monat schwanger“ (Lk 1,26). Dies geschieht somit etwa Ende Dezember. Die unbefleckte Empfängnis Jesu fällt daher auf den 25. März, den die Kirche bis heute als Fest der Verkündigung feiert. Rechnet man von diesem Datum neun Monate weiter, kommt man wiederum zum 25. Dezember.
Diese Berechnung ist keine moderne Spekulation, sondern wurde bereits im 3. Jahrhundert vom christlichen Historiker Sextus Julius Africanus (ca. 160–240) in seiner Chronographia dargelegt. Er schrieb dort:
„Die Inkarnation des Herrn geschah am 25. März. […] Daraus folgt, dass Seine Geburt am 25. Dezember war.“
Diese Tradition wurde von mehreren Kirchenvätern übernommen und diente später auch als Grundlage der liturgischen Festlegung.
Der „Integritätsgedanke“: Ein theologisches Zeitverständnis
Ein tiefsinniger Gedanke, der sich in der frühen Christenheit verbreitete, ist der sogenannte Integritätsgedanke: Dass bedeutende Heilsereignisse auf den gleichen Kalendertag fallen. So nahm man etwa an, dass große Propheten an dem Tag starben, an dem sie geboren oder empfangen wurden. Auch Christus sollte – so der Gedanke – an dem Tag, an dem Er empfangen wurde, später für uns gestorben sein.
Da das Kreuzesgeschehen nach alter Tradition auf den 25. März datiert wurde, lag es nahe, in diesem Tag auch den Moment der Konzeptio Verbi, der Menschwerdung des Wortes, zu sehen. Die Inkarnation geschah somit exakt am Tag der Kreuzigung – die größte Tat Gottes beginnt und endet am selben Tag. Aus dieser Theologie ergibt sich dann wiederum der 25. Dezember als logisches Geburtsdatum.
Widerlegung des heidnischen Einwandes: War Christus nur ein „Sol Invictus“?
Kritiker führen gerne an, dass der 25. Dezember das Datum des heidnischen Festes „Sol Invictus“ gewesen sei, das dem Sonnengott geweiht war. Zwar ist es historisch korrekt, dass Kaiser Aurelian im Jahr 274 ein Fest zu Ehren des Sol Invictus auf den 25. Dezember legte. Doch gerade die zeitliche Reihenfolge widerlegt den Vorwurf, das Christentum habe dieses Datum einfach übernommen.
Denn wie wir gesehen haben, nennen Hippolyt (204 n. Chr.) und Julius Africanus (ca. 221 n. Chr.) den 25. Dezember vor der offiziellen Einführung des Sonnengott-Festes. Zudem zeigt die kirchliche Ablehnung heidnischer Kulte in dieser Zeit, dass eine Übernahme höchst unwahrscheinlich ist.
Im Gegenteil: Die Kirche setzte Christus bewusst als die wahre Sonne der Gerechtigkeit dem heidnischen Götzenbild entgegen. Schon der Prophet Maleachi hatte verkündet:
„Doch für euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln“ (Mal 3,20; Vulgata-Zählung).
Diese Prophetie erfüllte sich in Christus, dem Licht der Welt (Joh 8,12), das an jenem Tag aufstrahlte, an dem das natürliche Licht wieder zunimmt – dem Tag der Wintersonnenwende.
Die Kirche hat den 25. Dezember nicht übernommen, sondern geheiligt – sie hat ihn christologisch umgedeutet, nicht synkretistisch vereinnahmt.
Die liturgische Tiefe des Weihnachtsdatums
Dass die Kirche gerade die längste Nacht des Jahres erwählt, um das Fest des Lichtes zu feiern, ist nicht Zufall, sondern Offenbarung in Symbolik. Die ganze Schöpfung scheint mitzusingen:
„Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ (Joh 1,5)
In der dunkelsten Zeit, wenn die Welt von Kälte und Nacht umhüllt ist, kommt der Logos, das wahre Licht, herab in die Armut einer Krippe. Seit diesem Tag nimmt das Licht wieder zu – nicht nur astronomisch, sondern heilsökonomisch. Die Liturgie der Kirche hat diesen Zusammenhang von Kosmos und Christus tief verinnerlicht.
Ein Datum mit Herz, Verstand und Gnade
Der 25. Dezember ist mehr als ein schönes Brauchtumsdatum. Er ist getragen von biblischer Logik, liturgischer Tiefe, patristischer Weisheit und einer Theologie der Heilsgeschichte. Wer meint, es handle sich dabei lediglich um eine spätantike Übernahme heidnischer Bräuche, unterschätzt die spirituelle Klarheit der Kirchenväter und die heilsgeschichtliche Dimension, die die Kirche unter der Führung des Heiligen Geistes seit ihren ersten Jahrhunderten entfaltet hat.
Die Feier der Geburt Christi am 25. Dezember ist somit nicht nur eine fromme Gewohnheit, sondern womöglich ein wahrer historischer Ausdruck jenes einzigartigen Wunders: dass der ewige Sohn Gottes wirklich Mensch wurde – zu einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, in der „Fülle der Zeit“ (Gal 4,4).
Christus ist nicht nur „in die Welt“ gekommen – er ist wirklich geboren. Und alles spricht dafür, dass es in der heiligen Nacht des 25. Dezembers geschah.