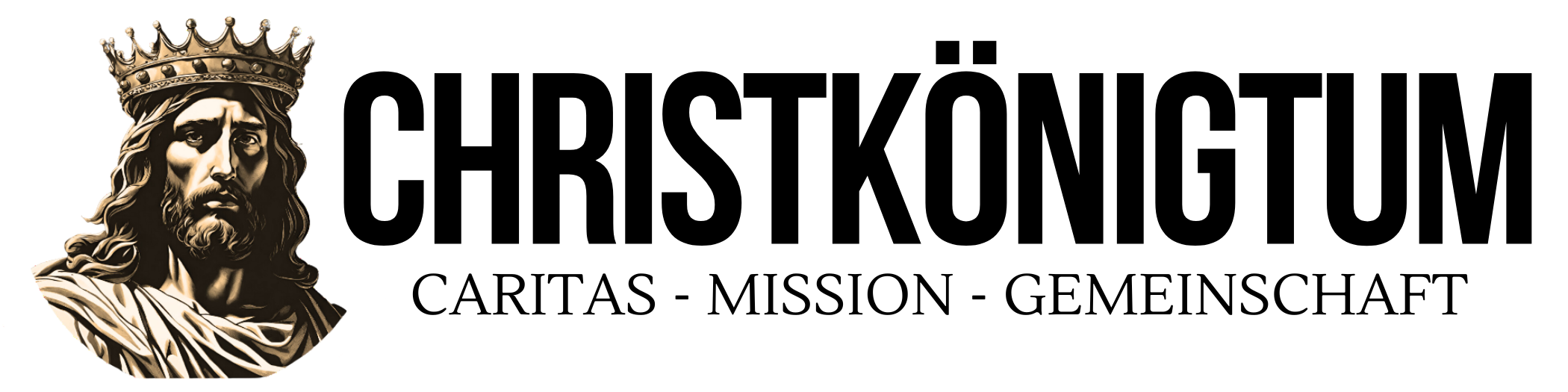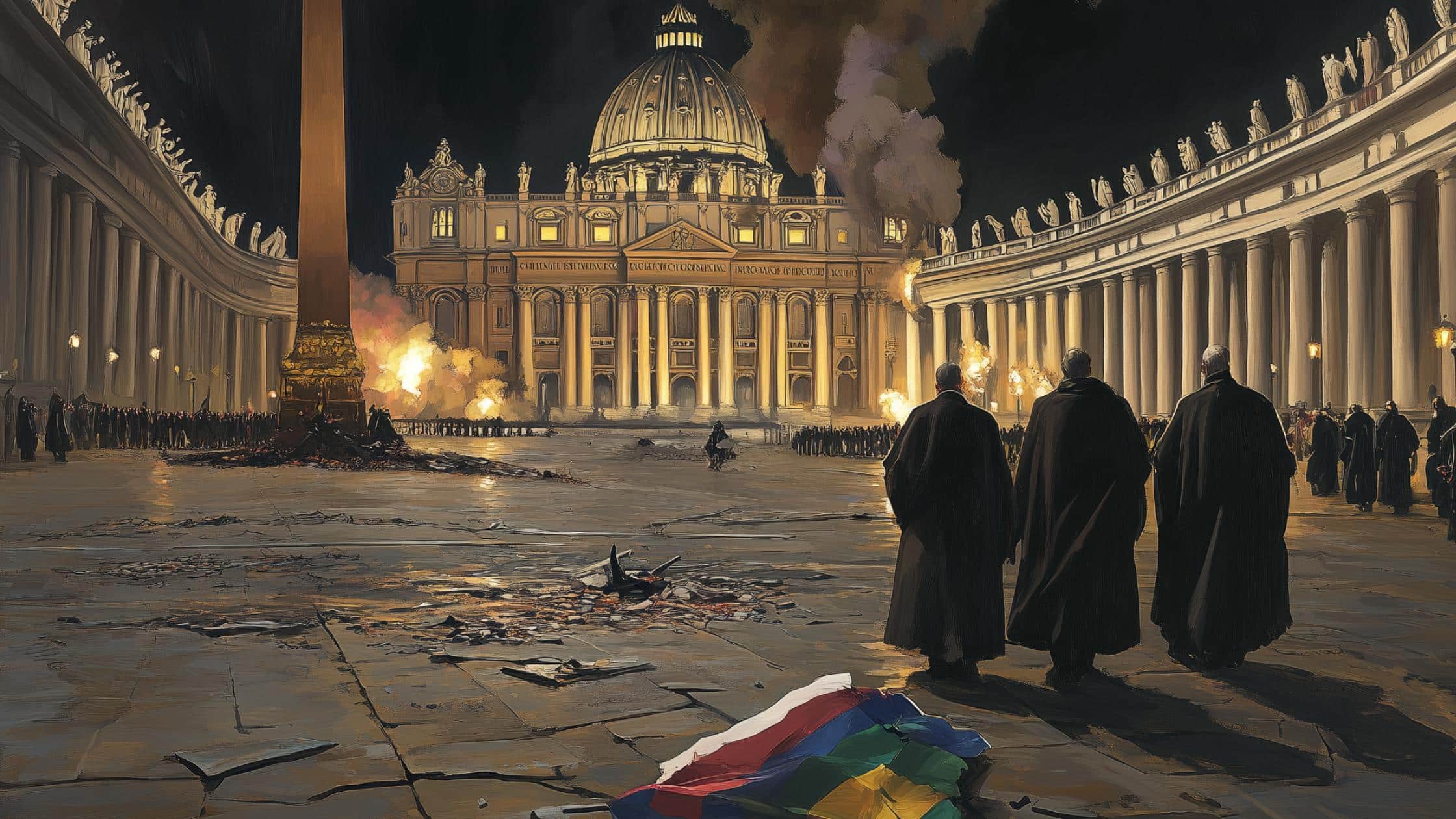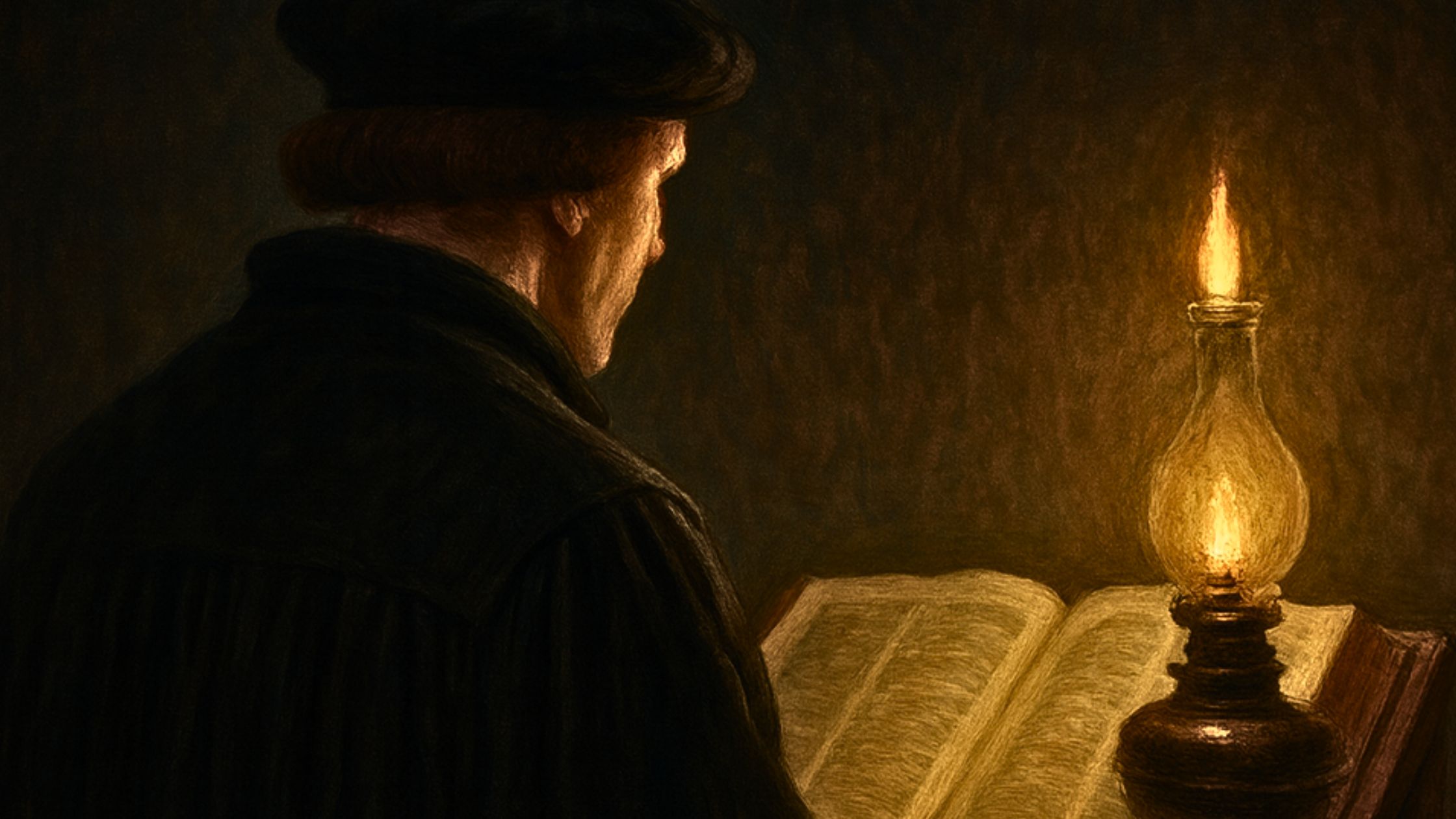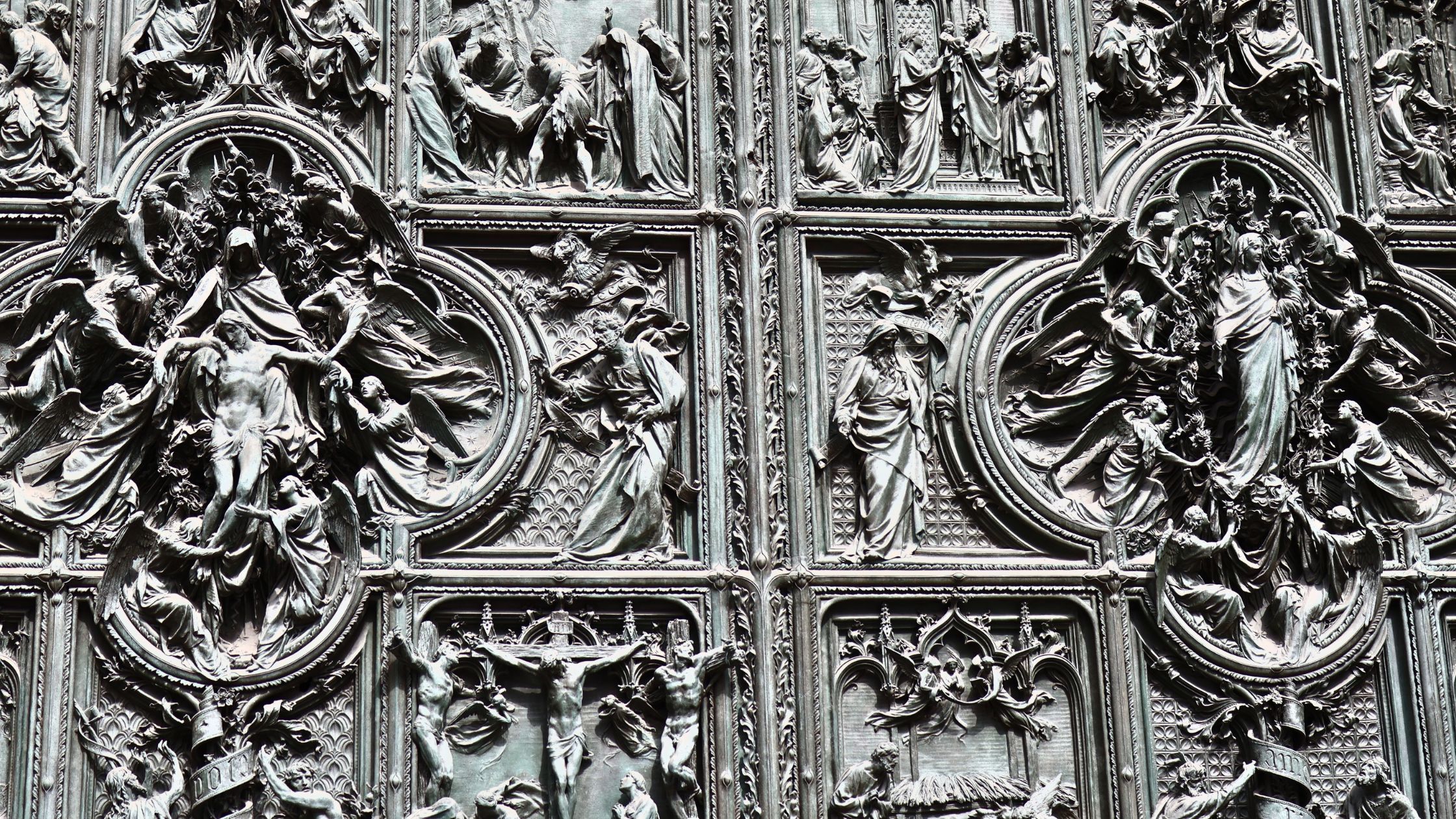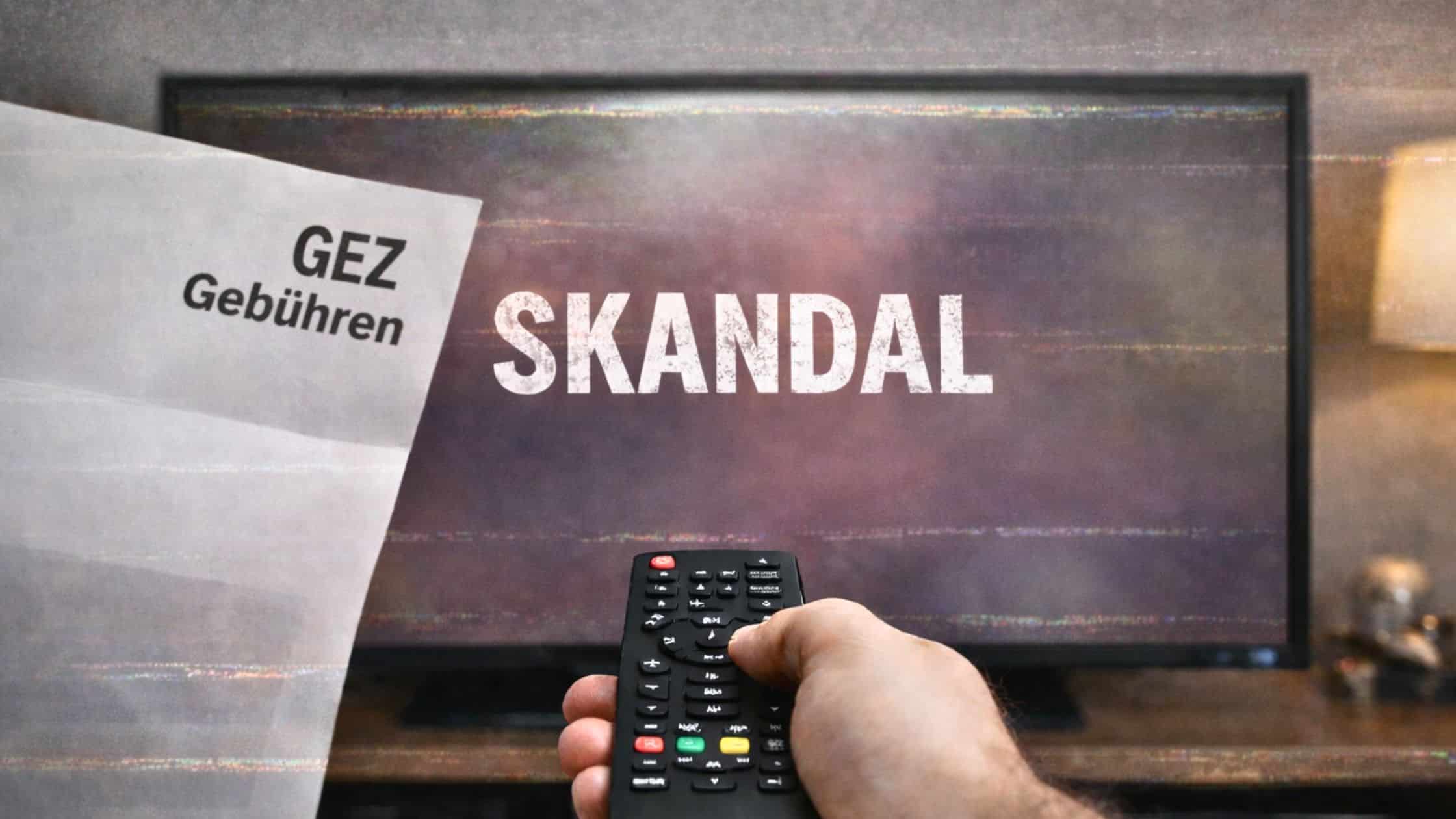Unter allen Tugenden, die den Menschen Gott ähnlich machen, nimmt die völlige Gleichförmigkeit des eigenen Willens mit dem Willen Gottes einen einzigartigen Platz ein. Sie ist nicht nur der Prüfstein der wahren Liebe zu Gott, sondern auch das Fundament der Heiligkeit. Unser Herr selbst hat dies durch Sein Leben auf Erden vorgelebt: „Damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe, und tue, wie mir der Vater befohlen hat“ (Joh 14,31). Der göttliche Heiland kam nicht, um den eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der Ihn gesandt hat. Darin liegt das höchste Beispiel für alle, die Gott lieben wollen.
Die Heiligung des Menschen und der Wille Gottes
Das ewige Heil des Menschen hängt untrennbar mit der Liebe zu Gott zusammen. Wer nicht liebt, bleibt im geistlichen Tod (vgl. 1 Joh 3,14). Die Vollkommenheit dieser Liebe offenbart sich darin, dass der Mensch in allem den göttlichen Willen sucht und bejaht. Wie Dionysius der Areopagit lehrt, ist die eigentliche Wirkung der Liebe, den Willen der Liebenden so zu einen, dass sie nur noch ein Herz und einen Willen haben. Darum sind alle Werke – Gebete, Opfer, Werke der Barmherzigkeit – nur insofern Gott wohlgefällig, als sie Seinem Willen entsprechen. Selbst äußerlich gute Handlungen verlieren ihren Wert, wenn sie dem göttlichen Willen widersprechen.
Christus selbst erklärte, dass nur derjenige Sein wahrer Bruder, Schwester und Mutter sei, der den Willen des himmlischen Vaters erfüllt (vgl. Mt 12,50). Die Heiligen des Himmels sind vollkommen, weil ihr Wille in vollkommener Harmonie mit dem Willen Gottes steht. Daher lehrte der Herr, dass wir bitten sollen: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden“ (Mt 6,10). Die heilige Teresa von Ávila sah in dieser Vereinigung des eigenen Willens mit dem göttlichen Willen die höchste Vollkommenheit und den Schlüssel zu reichem inneren Wachstum.
Die Größe der Willenshingabe
Ein einziger Akt vollkommenster Hingabe des eigenen Willens an Gott kann den Menschen zur Heiligkeit führen. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus dem Herrn begegnete, sprach er nur: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ (Apg 9,6). Mit dieser Antwort übergab er Gott die Herrschaft über sein ganzes Leben und wurde zum „Gefäß der Auserwählung“. Wer seinen Willen Gott schenkt, gibt Ihm nicht nur einen Teil seiner Güter oder Kräfte, sondern alles, was er ist. Darum sagt die Schrift: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz“ (Spr 23,26).
Die Bereitschaft im täglichen Leben
Damit der Mensch in jeder Lage den Willen Gottes befolgen kann, muss er sich bereits vorher in beständiger Bereitschaft halten. König David war stets bereit zu tun, was Gott verlangte, und bat: „Lehre mich, deinen Willen zu tun“ (Ps 142,10). Die heilige Teresa brachte sich täglich viele Male Gott dar, bereit, sowohl Angenehmes als auch Widerwärtiges aus Seiner Hand anzunehmen. Vollkommenheit besteht gerade darin, nicht nur im Glück, sondern auch in Prüfungen den Willen Gottes zu bejahen. Darum ist ein „Gott sei gelobt“ in der Bedrängnis kostbarer als tausend Danksagungen im Überfluss.
Diese Ergebung muss sich nicht nur auf Prüfungen beziehen, die Gott unmittelbar sendet – wie Krankheit, Verlust oder Tod –, sondern auch auf jene Leiden, die durch Menschen verursacht werden, die Gott zwar nicht in ihrer Sünde will, deren Wirkung Er aber zulässt, um den Seinen Gelegenheit zur Geduld zu geben. Alles, was geschieht, ist in Seiner Vorsehung geordnet.
Die wahre Sicht der Leiden
Was wir in unserem natürlichen Empfinden als Unglück bezeichnen, ist aus Sicht des Glaubens oft ein verborgenes Gut. Die größten Kronen der Heiligen wurden aus den Edelsteinen des Leidens geformt. So konnte der heilige Ijob sprechen: „Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; wie es dem Herrn gefallen hat, so ist es geschehen. Der Name des Herrn sei gepriesen“ (Ijob 1,21). Selbst in den Martern bekannten die Heiligen, dass sich der Wille Gottes in ihnen erfüllen möge.
Ein Beispiel dafür gibt der Bericht über einen Ordensmann, der trotz fehlender außergewöhnlicher Strenge viele Wunder wirkte. Auf die Frage seines Abtes antwortete er, dass er nur immer darauf bedacht sei, seinen Willen dem Willen Gottes anzupassen – und selbst über Verluste dem Herrn dankte. Hierin erkannte man die Quelle seiner Heiligkeit.
Die Frucht des Friedens
Wer in allem den göttlichen Willen sucht, besitzt jenen tiefen Frieden, den die Engel bei der Geburt Christi verkündeten und der „allen Begriff übersteigt“ (Phil 4,7). Solche Seelen gleichen der Sonne, die unverändert leuchtet, auch wenn Wolken sie zeitweise verhüllen. Äußere Veränderungen können sie nicht aus der Ruhe bringen, weil ihr Inneres auf Gott gegründet ist.
Wie ein Mensch, der hoch über den Wolken steht, unberührt vom Sturm unter ihm, so lebt der Gottgeweihte in unerschütterlichem Frieden. Alles, was ihm begegnet – ob Wetter, Verlust, Verfolgung, Krankheit oder Tod –, nimmt er an, weil er weiß: „So will es Gott.“ In dieser Annahme findet er Freude und Trost, wissend, dass jedes Kreuz, das in Ergebung getragen wird, Gott die größte Ehre gibt.
Der Widerspruch gegen den Willen Gottes
Wer dagegen dem Willen Gottes widerstrebt, vermehrt sein Kreuz und beraubt sich des Friedens. Kein Widerspruch vermag den Plan Gottes zu vereiteln: „Wer kann seinem Willen widerstehen?“ (Röm 9,19). Widerstand macht die Last nur drückender, Geduld hingegen verwandelt sie in ein Mittel der Heiligung. Denn Gott sendet die Prüfungen nicht, um zu verderben, sondern „damit wir uns heiligen“ (1 Thess 4,3). „Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten“ (Röm 8,28).
Schlussgedanke
Das Ziel des christlichen Lebens ist die vollkommene Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Alles geistliche Streben – Gebet, Sakramente, Buße, Werke der Liebe – muss auf dieses Ziel hingeordnet sein. Der beständige Ruf des Herzens soll lauten: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ und „Dein Wille geschehe“. Wer in dieser Haltung lebt und stirbt, stirbt als Freund Gottes und geht ein in die ewige Freude, wo kein Wollen mehr vom göttlichen Wollen getrennt ist.