Als im Jahr des Herrn 711 islamische Heere unter dem Berbergeneral Tariq ibn Ziyad die Meerenge von Gibraltar überquerten und das christliche Westgotenreich in Spanien binnen weniger Jahre zerschlugen, begann eines der längsten und bedeutsamsten Kapitel der katholischen Weltgeschichte: die Reconquista – die Rückeroberung Spaniens durch katholische Christen vom Joch des Islam.
Die Invasion
Die mohammedanische Invasion – vom islamischen Kalifat in Damaskus unterstützt – brachte das Kreuz in schwere Bedrängnis. Die Städte Toledo, Sevilla, Córdoba und Granada fielen in kurzer Zeit, Kirchen wurden zu Moscheen, Klöster zerstört, katholische Bischöfe vertrieben, der christliche Gottesdienst massiv eingeschränkt. Christen wurden zu Dhimmi degradiert, Menschen zweiter Klasse im eigenen Land, gezwungen zur Sondersteuer (Jizya), religiös gedemütigt und kulturell unterdrückt. Die mohammedanische Herrschaft, bekannt unter dem Namen al-Andalus, war ein islamischer Kolonialstaat, der auf dem Blut der eroberten Christen aufgebaut wurde.
Doch nicht alle Christen fügten sich. In den Bergen Asturiens, im äußersten Norden der Halbinsel, regte sich bereits wenige Jahre nach der Katastrophe der erste katholische Widerstand.
Pelayo und Covadonga – Der Beginn der Gegenwehr (722)
Der westgotische Adlige Pelayo (Pelagius), dem die Unterwerfung unter islamische Oberherrschaft unerträglich war, sammelte eine kleine Schar von Getreuen in den unwegsamen Tälern Asturiens. In einer Schlucht nahe Covadonga stellte sich Pelayo mit einer Handvoll Kämpfer gegen ein weit überlegendes islamisches Heer. Doch – so berichten die Chroniken – unter dem Schutz der Muttergottes und im Vertrauen auf göttliche Hilfe besiegten die Christen die Mauren. Die Schlacht von Covadonga im Jahr 722 war der erste militärische Sieg der Christen über die mohammedanischen Invasoren – und gilt als Beginn der Reconquista.
Aus diesem Widerstand formte sich das kleine Königreich Asturien, das später in León aufging. Es war nicht nur politisch, sondern geistlich begründet: Die christlichen Herrscher sahen sich als Verteidiger des wahren Glaubens. Ihre Herrschaft war eng mit dem katholischen Klerus verbunden. Klöster wie San Pedro de Siresa oder Samos wurden zu Bollwerken des Glaubens, Orte des Gebets und der Bildung – geistliche Kraftquellen für den Kampf gegen den Islam.
Der lange Kampf – Glaube, Königreiche, Kreuz
Im Verlauf des 9. und 10. Jahrhunderts konsolidierten sich die christlichen Königreiche: León, Navarra, Kastilien, Aragón. Sie führten einen oft mühsamen, langsamen und verlustreichen Kampf gegen die militärisch überlegenen islamischen Kalifate, die zeitweise über die stärksten Armeen und modernste Kultur der Region verfügten.
Trotz aller Rückschläge gab es Hoffnung. Die Entdeckung des Grabes des Apostels Jakobus des Älteren in Santiago de Compostela im 9. Jahrhundert war ein geistlicher Meilenstein. Das dort errichtete Heiligtum wurde zum bedeutendsten Wallfahrtsort des Mittelalters nach Rom und Jerusalem – und das Schwert des heiligen Jakobus wurde zum geistigen Banner der Reconquista. In vielen Berichten erscheint Santiago Matamoros („Jakobus, der Maurentöter“) in Schlachten auf weißem Pferd, um den katholischen Kämpfern beizustehen – ein starkes Bild katholischer Frömmigkeit und Hoffnung in schweren Zeiten.
El Cid – Der katholische Krieger (11. Jahrhundert)
Im 11. Jahrhundert trat ein katholischer Ritter hervor, der später zum Nationalhelden Spaniens werden sollte: Rodrigo Díaz de Vivar, genannt El Cid Campeador. Geboren um 1043 bei Burgos, diente er zunächst dem kastilischen König, wurde später aus politischen Gründen verbannt und führte als unabhängiger Heerführer christliche Feldzüge.
Sein größter Sieg war die Eroberung Valencias im Jahr 1094, die er bis zu seinem Tod 1099 als katholische Bastion gegen den Islam hielt. El Cid galt als tief gläubiger Mann: Er ließ Messen feiern, unterstützte Klöster und betrachtete sich selbst als Werkzeug Gottes im Kampf gegen den Unglauben. Sein Wirken zeigte, dass auch Einzelne – mit Mut und Glaube – Geschichte schreiben können.
Der Höhepunkt der Reconquista: 11.–13. Jahrhundert
Im 12. und 13. Jahrhundert gewann die Reconquista deutlich an Fahrt. Unter Königen wie:
Alfons VI. von León und Kastilien – Rückeroberung von Toledo (1085),
Alfons I. von Aragón – mutiger Vorkämpfer mit vielen Siegen im Osten,
Sancho der Große von Navarra – vereinte große Teile Nordspaniens,
Ferdinand II. und Alfons VIII. von Kastilien – Verteidiger der Christenheit,
wurden große Teile der Iberischen Halbinsel vom Islam befreit. Besonders die Schlacht von Las Navas de Tolosa (1212) war entscheidend: Ein vereintes Heer aus Kastilien, Aragón, Navarra und León – unterstützt vom Papst mit einem echten Kreuzzugsbann – besiegte das islamische Heer der Almohaden vernichtend. Der Weg nach Süden war nun offen.
Die Heiligen Könige – Ferdinand III. und Jakob I. (13. Jahrhundert)
Zwei Monarchen verdienen besondere Erwähnung:
Ferdinand III. der Heilige (1199–1252) – König von Kastilien und León, wurde 1671 heiliggesprochen. Er eroberte Córdoba, Jaén und Sevilla, führte Prozesse zur Neu-Weihe der Kathedralen ein, lebte asketisch, betete täglich und starb in Ruf der Heiligkeit.
Jakob I. von Aragón (1208–1276) – genannt “der Eroberer”, eroberte Valencia, Mallorca und weite Teile des Ostens, stets im festen Vertrauen auf die Vorsehung. Er war ein tiefgläubiger König, der häufig Beichte empfing, Klöster gründete und das Recht unter katholischem Geist ordnete.
Mit diesen Königen nahm das christliche Spanien fast seine heutige Gestalt an – außer Granada, das letzte mohamedanische Emirat, das wie ein Stachel im Fleisch der Reconquista blieb.
Die Vollendung – Isabella die Katholische und der Fall Granadas (1492)
Der endgültige Triumph der Reconquista kam durch Gottes Vorsehung im Jahr 1469, als Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón heirateten. Ihre Ehe vereinte die zwei größten christlichen Königreiche – und damit auch den Willen zur geistlichen und militärischen Vollendung der Reconquista.
Isabella war eine der bedeutendsten katholischen Monarchinnen der Geschichte: tiefgläubig, regelmäßig kommunizierend, persönlich bescheiden, mutig in Staatsfragen. Ihr Ziel war es, Spanien vollständig dem Kreuz zurückzugeben. Die Kampagne gegen das Emirat Granada (1482–1492) war lang, aber zielgerichtet, geführt mit ritterlicher Strenge und geistlicher Kraft. Beichtväter, Bischöfe, Priester begleiteten die Truppen; die Messe wurde selbst auf den Schlachtfeldern gefeiert.
Am 2. Januar 1492 schließlich übergaben die muslimischen Herrscher Granadas den Schlüssel der Stadt. Die katholischen Monarchen Ferdinand und Isabella hielten feierlich Einzug, die Fahne des Kreuzes wurde auf der Alhambra gehisst, die Glocken der Kirchen läuteten nach Jahrhunderten des Schweigens. Die Reconquista war beendet.
In der Folgezeit setzte Isabella durch, dass die Mohammedaner, die sich weigerten, sich taufen zu lassen, das Land verlassen mussten. Damit wurde der jahrhundertelangen islamischen Herrschaft ein geistlicher und politischer Schlussstrich gezogen. Spanien sollte wieder ganz und gar Land des katholischen Glaubens sein – durchdrungen vom Evangelium, geeint im Bekenntnis zur Kirche, geheiligt durch das Blut der Märtyrer und das Gebet der Gerechten.
Geistliche Bedeutung und Vermächtnis
Die Reconquista war mehr als ein Krieg. Sie war eine geistliche Mission, ein langer Akt der Treue gegen den Islam, der über Jahrhunderte versuchte, Europa vom Evangelium zu trennen. Die Christen Spaniens – Männer und Frauen, Ritter und Mönche, Könige und Bäuerinnen – standen über acht Jahrhunderte hinweg treu zum Glauben. Ihre Geschichte ist ein Zeugnis für Mut, Ausdauer, Opfer und Gnade.
Die Kirche ehrte viele dieser Kämpfer: Ferdinand III., Raymund von Fitero (Gründer des Ritterordens von Calatrava), zahlreiche Märtyrer der maurischen Verfolgungen, und natürlich Isabella die Katholische, die als „Dienerin Gottes“ für eine Seligsprechung vorgesehen ist.
Die Reconquista lehrt uns: Der Glaube muss nicht nur verkündet, sondern verteidigt werden. Sie zeigt, dass das Kreuz nicht durch Gleichgültigkeit, sondern durch Treue siegt. In einer Welt, die versucht, christliche Geschichte zu entwerten oder zu verschweigen, ist die Erinnerung an die Reconquista ein Akt geistlicher Gerechtigkeit. Möge Gott uns die gleiche Entschlossenheit und den gleichen Glauben schenken, wie jenen Helden, die acht Jahrhunderte lang nicht aufgaben – bis das Kreuz wieder siegte.
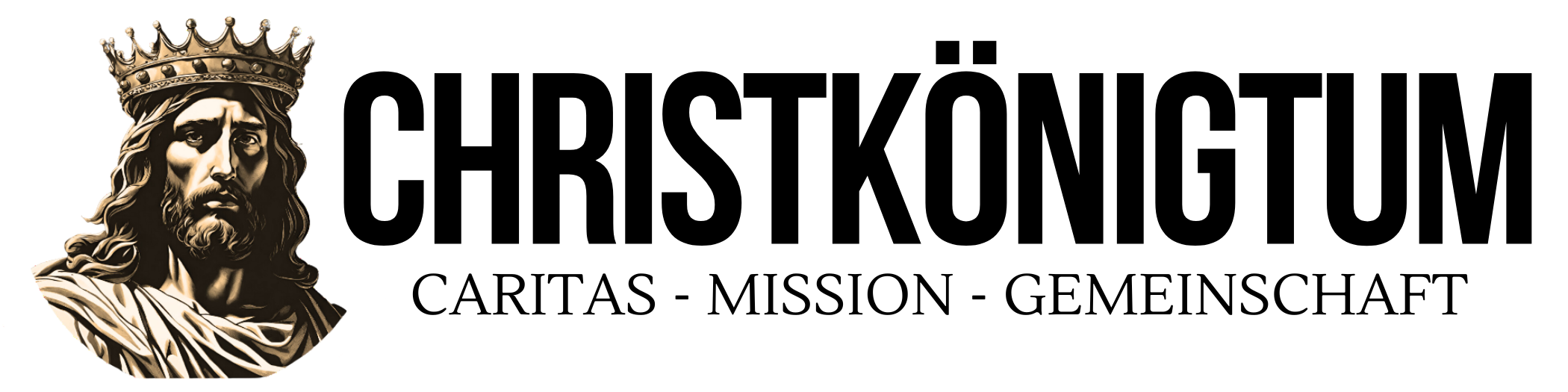









2 Antworten
Das ist dennoch nicht der Weg und die Mittel, den uns Jesus Christus lehrte. Auch Er lebte in einem besetzten Land, aber sagte niemals “bekämpft die Römer”. Ganz im Gegenteil, wächst damals wie heute das Christentum dort wo nicht zurückgeschlagen, sondern unter eigenen Opfern das Evangelium verkündet wird.
Hätte man damals, wie so oft, nicht gegen den Islam gekämpft sondern nur wäre nur dieses “Weichspülprogramm” gefahren worden, gäbe es heute Europa nicht bzw. kein christliches Europa! Es ist leider immer die selbe Leier heutzutage, als Christ darf man(n) sich nicht wehren, halte die andere Backe auch noch hin usw….Ich vergleiche es mit der vergessen Gerechtigkeit Gottes, heute gibt es nur noch die Barmherzigkeit Gottes aber ohne die Gerechtigkeit Gottes. Wo soll denn das Evangelium verkündet werden wenn es keine Messe, keine Kirchen, keinen Priester und somit keine Christen mehr gibt da sie getötet oder vertrieben wurden? Danken wir Gott für diese tapferen und Gläubigen Männer und Frauen die bereit waren ihr Leben für Christus und die katholische Kirche zu geben.