Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, wonach ein Kruzifix im Eingangsbereich eines Gymnasiums gegen die Glaubensfreiheit zweier Schülerinnen verstoßen haben soll, markiert nicht nur einen juristischen, sondern auch einen kulturellen Einschnitt – einen, der das katholische Erbe Bayerns erneut infrage stellt. Zwei junge Frauen, inzwischen Abiturientinnen, hatten sich erfolgreich gegen das Kreuz an ihrer Schule gewandt. Der Staat, so das Gericht, hätte dieses Zeichen christlicher Prägung entfernen müssen.
Angriff auf Glaube und Kultur
Bayern ist nicht irgendein Bundesland. Es ist ein historisch gewachsener Kulturraum, dessen Identität untrennbar mit dem katholischen Glauben verknüpft ist. Kirchen, Wallfahrtsorte, christliche Feiertage und religiöse Kunst prägen Städte und Dörfer – und eben auch Schulen. Das Kreuz ist dabei weit mehr als ein religiöses Symbol. Der katholische Glaube repräsentiert die Grundwerte, die unser Bildungssystem tragen sollte.
Die juristische Argumentation mag sich auf das Grundrecht der Glaubensfreiheit stützen. Doch es drängt sich die Frage auf, wessen Freiheit hier in Wahrheit eingeschränkt wird. Die der beiden Klägerinnen – oder die einer schweigenden Mehrheit, die mit dem Kreuz kein Problem hat, ja es womöglich sogar als integralen Bestandteil ihrer religiösen Identität empfindet? Ist es gerecht, jahrhundertealte Symbole aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, weil sich Einzelne daran stören?
Bayerische Bevölkerung lehnte den Kruzifixbeschluss schon ab
Bereits der sogenannte Kruzifixbeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1995 sorgte für breite Ablehnung in der bayerischen Bevölkerung – zu Recht. Der Freistaat reagierte damals mit einer gesetzlichen Neuregelung, die in Grundschulen eine differenzierte Lösung vorsieht. Für weiterführende Schulen wie Gymnasien fehlt eine solche Regelung jedoch bislang. Der aktuelle Fall zeigt deutlich: Es besteht akuter Handlungsbedarf, der kulturellen Realität Bayerns in der Gesetzgebung wieder stärker Rechnung zu tragen.
Dass das Gericht dem Kruzifix vorwirft, an exponierter Stelle zu hängen und eine figürliche Darstellung des gekreuzigten Christus zu zeigen, offenbart ein befremdliches Verhältnis zur kulturellen und künstlerischen Ausdrucksform der christlichen Religion. Sollen wir also in Zukunft auch die barocken Altarbilder aus bayerischen Museen und Kirchen entfernen, weil sie realistische Darstellungen Christi zeigen? Dazu passt das Wort aus der heiligen Schrift: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen; uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. (1. Korinther 1,18).
Das Kreuz gehört zu Bayern und ganz Deutschland
Das Kreuz gehört zu Bayern – nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung. Wer es aus öffentlichen Einrichtungen verdrängt, verdrängt damit auch einen Teil der Geschichte, der Kultur und der Werte dieses Landes. Es darf nicht sein, dass eine Religion, die über Jahrhunderte hinweg Identität gestiftet hat, immer weiter aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt wird, während die religiöse und kulturelle Beliebigkeit zur neuen Norm wird. Islamische Feiertage und islamische Symbole finden immer mehr Raum in der Öffentlichkeit, und werden lautstark eingefordert. Wohingegen das katholische Erbe Deutschlands unterdrückt und aus dem Gedächtnis der Bevölkerung gelöscht wird.
Das Urteil ist ein Warnsignal. Es zeigt, dass der Schutz religiöser Symbole in Bayern kein Selbstläufer mehr ist. Wenn das Kreuz in Schulen fällt, fällt es vielleicht bald auch in Rathäusern, Gerichtssälen oder Universitäten. Dann aber verliert Bayern mehr als nur ein Stück Holz an der Wand – es verliert ein Stück seiner Seele, die durch die katholische Religion über Jahrhunderte geformt wurde.
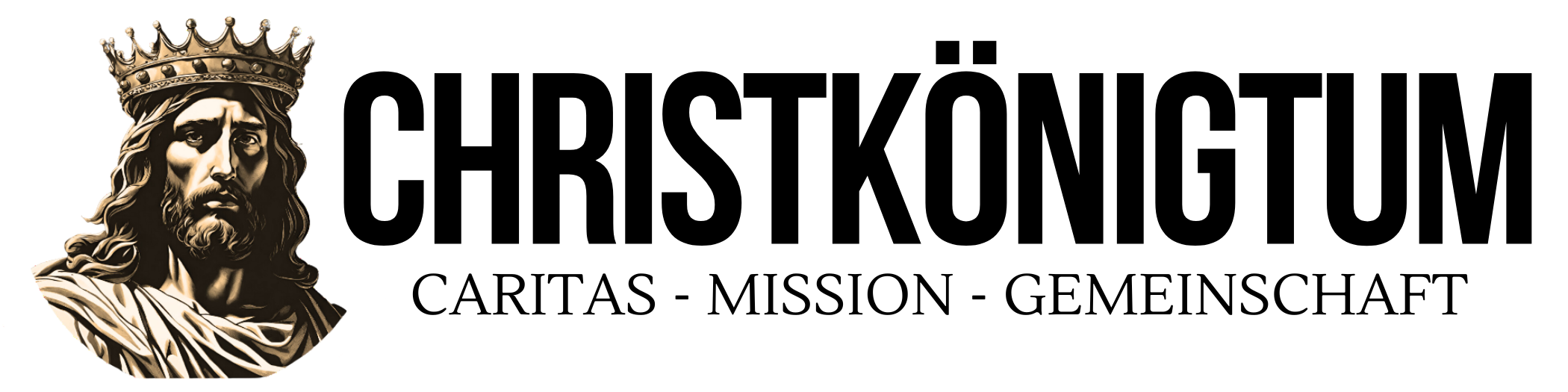
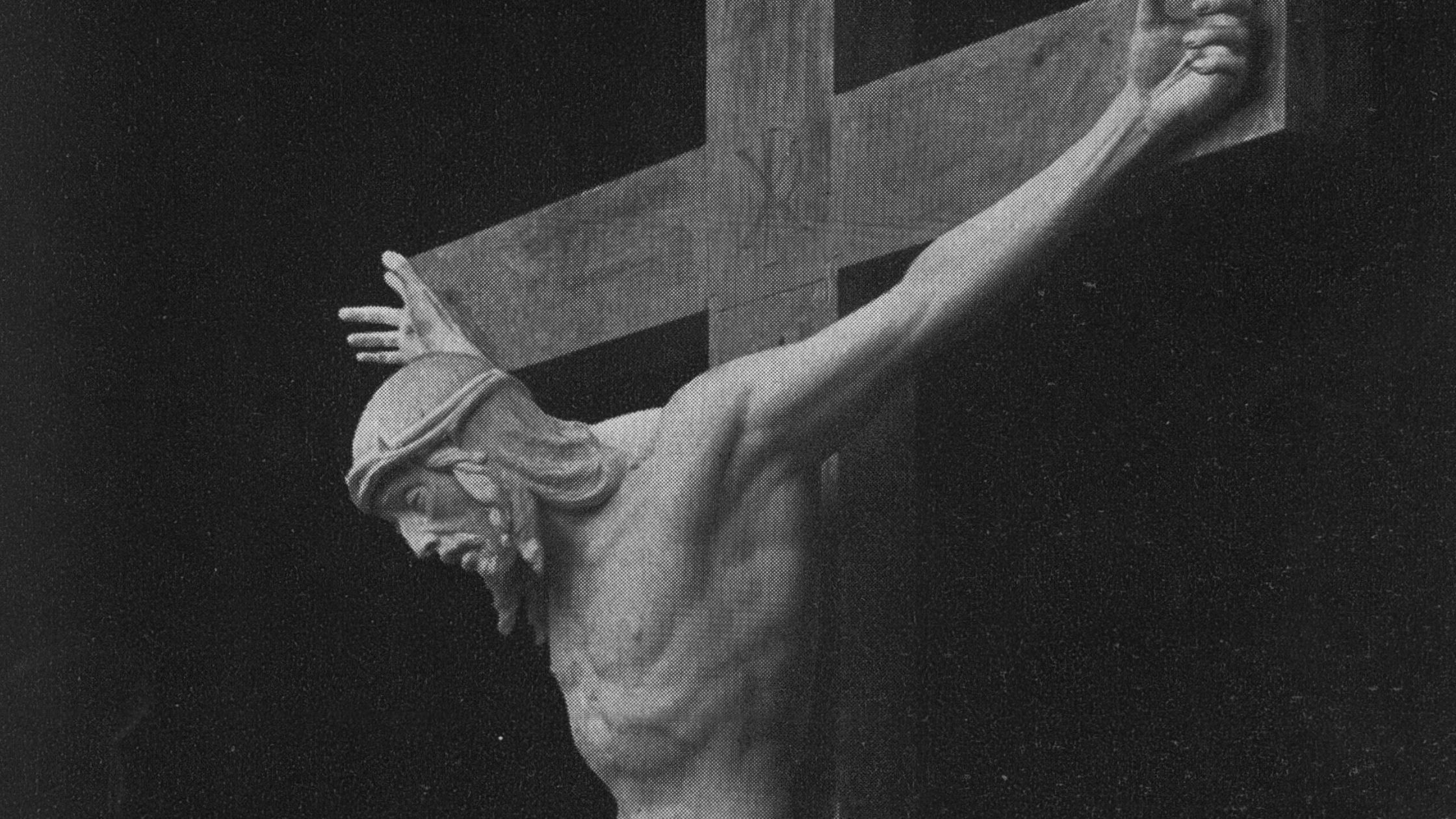







Eine Antwort
Kann man hier eine Petition starten indem man darauf hinweist das es zu unserem Christlichen Werten und Abendland gehört sich an unserem Heiland und Erlöser Jesus Christus mit dem Zeichen des Kruzifixes daran zu erinnern. das er sich für unsere Sünden geopfert hat?